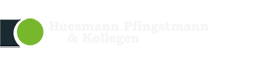News-Archiv
Krankenkasse: Beiträge auf Rekordniveau
01/2026 - Zum Jahreswechsel erhöht rund die Hälfte der gesetzlichen Krankenkassen ihre Beiträge. Das ergibt eine Auswertung der Stiftung Warentest, die in einer Online-Datenbank die Beiträge und Leistungen der Kassen vergleicht. Ein Wechsel der Krankenkasse ist einfach möglich.
„Von den 72 für alle Verbraucher geöffneten Kassen haben zum Januar 35 ihre Beiträge erhöht. 36 Kassen lassen die Beiträge unverändert, eine senkt sogar. Die Erhöhungen liegen zwischen 0,20 und 1,10 Prozentpunkten.
Die teuerste Krankenkasse verlangt einen Beitrag von 18,99 Prozent, die günstigste von 16,78 Prozent.
Durch einen Wechsel der Krankenkasse können Versicherte teils mehrere hundert Euro im Jahr sparen. Das geht einfach: Nach einem Antrag bei der neuen Kasse übernimmt diese die Kündigung bei der alten. Anschließend muss nur noch der eigene Arbeitgeber informiert werden.
Jedoch sollte man nicht allein auf die Beitragssätze achten, rät Testleiterin Sabine Baierl-Johna: „Zuschüsse zur Zahnreinigung, zu Gesundheitskursen oder ein attraktives Bonusprogramm können einen etwas höheren Beitragssatz rechtfertigen.“
Einen umfangreichen Vergleich mit allen aktuellen Beitragssätzen und Extraleistungen von 67 geöffneten Kassen bietet die Stiftung Warentest unter www.test.de/krankenkassen. Hier können Versicherte auch berechnen, wieviel sie durch einen Wechsel der Krankenkasse sparen.
Pressemitteilung der Stiftung Warentest: Krankenkassen: Beiträge auf Rekordniveau
Krankenkassenwechsel: Verbraucherzentrale fordert unabhängiges Vergleichsportal
01/2026 - Die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung werden im kommenden Jahr steigen. Umso wichtiger ist es, die Krankenkasse sorgfältig zu wählen. Dabei ist nicht nur der Preis entscheidend, sondern auch Leistung und Qualität. Damit Versicherte einfach und transparent gesetzliche Krankenkassen vergleichen können, fordert der Verbraucherzentrale Bundesverband ein unabhängiges Vergleichsportal. Ramona Pop, Vorständin des Verbraucherzentrale Bundesverbands, kommentiert:
„Der Zusatzbeitragssatz der Krankenkassen steigt im Jahr 2026. Wer jetzt darüber nachdenkt, die Krankenkasse zu wechseln, sollte allerdings nicht nur auf die Kosten, sondern auch die angebotenen Leistungen achten. Doch bislang fehlt ein unabhängiges, öffentlich zugängliches Vergleichsportal, das neben dem Beitrag auch Servicequalität und Leistungsumfang transparent macht. In Deutschland gibt es über 90 gesetzliche Krankenkassen. Die Politik muss dafür sorgen, dass Versicherte diese sinnvoll vergleichen können. Ohne verlässliche Informationen zu Qualität und Service bleibt die Wahl der passenden Krankenkasse für viele ein Ratespiel – mit möglicherweise teuren Folgen.“
Die Mehrheit (59 Prozent) der Verbraucher:innen fände ein unabhängiges Vergleichsportal für Krankenkassen (auf jeden Fall bzw. eher) hilfreich, das neben Beitragshöhe und Leistungen auch Aspekte, wie Erreichbarkeit des Kundenservices, Unterstützung bei der Arztterminsuche oder Dauer der Antragsbearbeitung berücksichtigt. Das zeigt eine aktuelle, repräsentative forsa-Befragung im Auftrag des Verbraucherzentrale Bundesverbands. Vor allem jüngere Menschen (18-34 Jahre) sehen in einem solchen Vergleichsportal Vorteile, um die für sie persönlich beste Krankenkasse zu finden. In der Gruppe der 18-34-Jährigen geben 79 Prozent an, ein unabhängiges Krankenkassenvergleichsportal auf jeden Fall oder eher hilfreich zu finden. Aus Sicht des Verbraucherzentrale Bundesverbands sollte der Krankenkassenvergleich beim Nationalen Gesundheitsportal (gesund.bund.de) angesiedelt werden.
Hintergrund
Verbraucher:innen können nach Beitragserhöhungen per Sonderkündigungsrecht ihre Krankenkasse wechseln. Dafür fehlt aber bislang ein Vergleichsportal, in dem Verbraucher:innen Preise, Leistungen und Qualität der über 90 gesetzlichen Krankenkassen vergleichen können. Die Ampel-Koalition plante, mit dem Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz (GVSG) ein Krankenkassen-Vergleichsportal einzuführen, um erstmalig einen direkten Vergleich aller Einzelkassen anhand einheitlicher Qualitätskriterien zu ermöglichen. Das GVSG wurde im Laufe des Jahres 2024 beraten und trat am 1. März 2025 in Kraft. Die ursprünglich vorgesehene Regelung zur Einführung eines Krankenkassen-Vergleichsportals wurde im finalen Gesetz jedoch nicht berücksichtigt.
Pressemitteilung der Verbraucherzentrale: Krankenkassenwechsel: Verbraucherzentrale fordert unabhängiges Vergleichsportal
Mangelnde Transparenz bei Online-Bewertungen
12/2025 - Verbraucherzentralen mahnen 122 Anbieter ab – Kundenbewertungen spielen für viele Verbraucher:innen eine zentrale Rolle bei der Kaufentscheidung. Doch nicht immer ist klar, ob diese Bewertungen echt sind. Unternehmen, die Kundenbewertungen veröffentlichen, müssen daher offenlegen, ob und wie sie die Echtheit dieser Bewertungen prüfen. Dies ist jedoch nicht immer der Fall..
Zwischen April und Juli 2025 haben die Verbraucherzentralen und der Verbraucherzentrale Bundesverband in einer Gemeinschaftsaktion insgesamt 462 Webseiten von Online-Shops und Dienstleistern stichprobenartig geprüft. Das Ergebnis ist ernüchternd: 122 Anbieter informierten nicht oder nicht ausreichend über ihre Prüfverfahren – und wurden deshalb abgemahnt. Etwa jedes vierte Unternehmen hatte nicht oder nicht klar genug darüber informiert, ob und wie es die Echtheit der Bewertungen sicherstellt. In weiteren 15 Prozent der untersuchten Webseiten wurden keine Bewertungen veröffentlicht oder keine eindeutigen Verstöße festgestellt. Nicht einmal 60 Prozent der geprüften Anbieter handelten rechtskonform. „Kundenbewertungen können bei der Orientierung helfen. Daher ist es unerlässlich, dass Unternehmen offenlegen, ob und wie sie gegen Fakes vorgehen“, sagt Stefan Brandt, Sprecher der Gemeinschaftsaktion der Verbraucherzentralen. „Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen deutlich: Es besteht weiterhin großer Handlungsbedarf bei der Transparenz von Online-Bewertungen.“.
Bewertungen müssen rechtzeitig und deutlich erklärt werden
Unternehmen müssen ihren Umgang mit Bewertungen deutlich anzeigen, etwa auf der Startseite, der Produktübersicht oder unmittelbar neben einem Artikel. Es reicht nicht, entsprechende Hinweise nur auf einer Unterseite, im Kleingedruckten oder erst später im Bestellprozess bereitzustellen. „Gerade weil Bewertungen eine so große Rolle beim der Konsumentscheidung spielen, ist Transparenz hier besonders wichtig“, betont Brandt.
Rechtlicher Hintergrund
Die Transparenzpflicht ergibt sich aus dem Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (§ 5b Abs. 3 UWG), das europäisches Recht umsetzt (Artikel 3 Nr. 4 lit. c der Richtlinie (EU) 2019/2161). Es verpflichtet Unternehmer seit dem 28.05.2022 dazu, transparent zu machen, ob Bewertungen tatsächlich von Verbraucher:innen stammen, die die beworbenen Produkte oder Dienstleistungen auch genutzt oder gekauft haben. Wird eine solche Überprüfung nicht vorgenommen, muss auch dies offengelegt werden. Falls eine Prüfung erfolgt, sind klare Informationen über das Verfahren zur Echtheitskontrolle bereitzustellen – etwa, ob nur Bewertungen von Kund:innen akzeptiert werden, die über den eigenen Shop gekauft haben, oder ob alle Bewertungen – auch negative – veröffentlicht werden.
Pressemitteilung der Verbraucherzentrale: Mangelnde Transparenz bei Online-Bewertungen
Mangelnde Transparenz bei Online-Bewertungen
12/2025 - Verbraucherzentralen mahnen 122 Anbieter ab – Kundenbewertungen spielen für viele Verbraucher:innen eine zentrale Rolle bei der Kaufentscheidung. Doch nicht immer ist klar, ob diese Bewertungen echt sind. Unternehmen, die Kundenbewertungen veröffentlichen, müssen daher offenlegen, ob und wie sie die Echtheit dieser Bewertungen prüfen. Dies ist jedoch nicht immer der Fall..
Zwischen April und Juli 2025 haben die Verbraucherzentralen und der Verbraucherzentrale Bundesverband in einer Gemeinschaftsaktion insgesamt 462 Webseiten von Online-Shops und Dienstleistern stichprobenartig geprüft. Das Ergebnis ist ernüchternd: 122 Anbieter informierten nicht oder nicht ausreichend über ihre Prüfverfahren – und wurden deshalb abgemahnt. Etwa jedes vierte Unternehmen hatte nicht oder nicht klar genug darüber informiert, ob und wie es die Echtheit der Bewertungen sicherstellt. In weiteren 15 Prozent der untersuchten Webseiten wurden keine Bewertungen veröffentlicht oder keine eindeutigen Verstöße festgestellt. Nicht einmal 60 Prozent der geprüften Anbieter handelten rechtskonform. „Kundenbewertungen können bei der Orientierung helfen. Daher ist es unerlässlich, dass Unternehmen offenlegen, ob und wie sie gegen Fakes vorgehen“, sagt Stefan Brandt, Sprecher der Gemeinschaftsaktion der Verbraucherzentralen. „Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen deutlich: Es besteht weiterhin großer Handlungsbedarf bei der Transparenz von Online-Bewertungen.“.
Bewertungen müssen rechtzeitig und deutlich erklärt werden
Unternehmen müssen ihren Umgang mit Bewertungen deutlich anzeigen, etwa auf der Startseite, der Produktübersicht oder unmittelbar neben einem Artikel. Es reicht nicht, entsprechende Hinweise nur auf einer Unterseite, im Kleingedruckten oder erst später im Bestellprozess bereitzustellen. „Gerade weil Bewertungen eine so große Rolle beim der Konsumentscheidung spielen, ist Transparenz hier besonders wichtig“, betont Brandt.
Rechtlicher Hintergrund
Die Transparenzpflicht ergibt sich aus dem Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (§ 5b Abs. 3 UWG), das europäisches Recht umsetzt (Artikel 3 Nr. 4 lit. c der Richtlinie (EU) 2019/2161). Es verpflichtet Unternehmer seit dem 28.05.2022 dazu, transparent zu machen, ob Bewertungen tatsächlich von Verbraucher:innen stammen, die die beworbenen Produkte oder Dienstleistungen auch genutzt oder gekauft haben. Wird eine solche Überprüfung nicht vorgenommen, muss auch dies offengelegt werden. Falls eine Prüfung erfolgt, sind klare Informationen über das Verfahren zur Echtheitskontrolle bereitzustellen – etwa, ob nur Bewertungen von Kund:innen akzeptiert werden, die über den eigenen Shop gekauft haben, oder ob alle Bewertungen – auch negative – veröffentlicht werden.
Pressemitteilung der Verbraucherzentrale: Mangelnde Transparenz bei Online-Bewertungen
Online-Shopping: Mehrheit beklagt mangelnden Schutz vor unseriösen Anbietern
11/2025 - Online-Shopping boomt – doch bei irreführender Werbung oder versteckten Kosten, dem Schutz persönlicher Daten und Schutz vor Betrug oder unseriösen Anbietern fühlt sich die Mehrheit der Verbraucher:innen nicht gut geschützt. Das zeigt der Verbraucherreport 2025 des Verbraucherzentrale Bundesverbands. Die jährliche repräsentative Befragung zur Lage der Verbraucher:innen wurde von forsa durchgeführt. Ein Ergebnis: Der Gesetzgeber muss handeln und Verbraucher:innen beim digitalen Einkauf besser schützen.
„Online-Shopping gehört für viele zum Alltag. Doch irreführende Werbung, versteckte Kosten und Fakeshops machen den Einkauf zur digitalen Stolperstrecke. Verbraucherinnen und Verbraucher brauchen besseren Schutz – und zwar jetzt. Bundesregierung und Europäische Union müssen den Verbraucherschutz beim Online-Shopping konsequent weiterentwickeln. Online-Marktplätze dürfen sich nicht aus der Verantwortung stehlen können“, so Ramona Pop, Vorständin des Verbraucherzentrale Bundesverbands.
Zahlreiche Probleme beim Online-Shopping
Knapp zwei Drittel der Verbraucher:innen (65 Prozent) fühlen sich vor irreführender Werbung oder versteckten Kosten beim Online-Shopping eher nicht oder gar nicht gut geschützt. Die Mehrheit der Befragten sieht sich auch hinsichtlich ihrer persönlichen Daten (64 Prozent) und vor Betrug oder unseriösen Anbietern (60 Prozent) nicht ausreichend geschützt. Lediglich mit Blick auf ihre Rechte bei Widerruf und Rückgabe fühlt sich die Mehrheit der Verbraucher:innen (71 Prozent) eher oder sehr gut geschützt.
In den vergangenen zwei Jahren hatte eine deutliche Mehrheit (78 Prozent) der Befragten, die im Internet eingekauft haben, Probleme beim Online-Shopping. Über die Hälfte der Online-Shopper:innen (55 Prozent) gab an, dass Lieferzeiten länger waren als angegeben. Jeweils etwa die Hälfte nannte einen schlecht erreichbaren Kundenservice (51 Prozent) und eine mangelnde Qualität der Produkte (49 Prozent) als Problem. Nur gut ein Fünftel (22 Prozent) hatte in den vergangenen zwei Jahren keine Probleme beim Online-Einkauf.
Digitales bleibt Dauerbaustelle
Im ersten Halbjahr 2025 haben die Verbraucherzentralen über 165.000 Beschwerden registriert – ein Plus von 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Verbraucherreport 2025 zeigt, dass es bei den meisten in den Verbraucherzentralen erfassten Verbraucherbeschwerden um Schwierigkeiten im digitalen Bereich geht. Diese machen inzwischen über die Hälfte (57 Prozent) aller Beschwerden aus. Wie bereits im Vorjahr fühlen sich die Menschen hier am wenigsten geschützt: Mehr als die Hälfte der Befragten (54 Prozent) gibt an, sich eher nicht gut oder gar nicht im Bereich Internet und Digitalisierung geschützt zu fühlen.
„Das digitale Umfeld birgt zahlreiche Risiken für Verbraucherinnen und Verbraucher, wie Vertragsfallen und Datenmissbrauch. Mit manipulativen Designs und Sucht-Mechanismen werden die Schwächen von Verbraucher:innen gezielt ausgenutzt. Die bestehenden Regelungen reichen nicht aus, um einen echten Schutz zu gewährleisten. Die Europäische Kommission muss den anstehenden Digital Fairness Act nutzen und hier nachbessern. Manipulative Designs müssen konkret definiert und über die Schwarze Liste verboten werden. Wenn Unternehmen sich nicht an die Regeln halten, muss es Konsequenzen geben“, so Pop.
Politik ist in der Verantwortung
Verbraucherschutz ist weiterhin von hoher Bedeutung. Das bestätigt auch der aktuelle Verbraucherreport: Für 92 Prozent der Menschen ist er sehr bzw. eher wichtig, wenn es um ihre persönliche Sicherheit als Verbraucher:in geht. Wie bereits in den vergangenen Jahren sieht die überwiegende Mehrheit der Verbraucher:innen (86 Prozent) die Politik in eher oder sehr starkem Maße dafür verantwortlich, ihre Interessen zu schützen. Gleichzeitig vertraut ihr nur gut ein Fünftel (22 Prozent) eher oder sehr stark, dass sie dieser Verantwortung auch nachkommt.
„Verbraucherinnen und Verbraucher erwarten zu Recht, dass die Politik ihre Interessen schützt. Doch das Vertrauen darin, dass die Politik dieser Verantwortung gerecht wird, ist seit Jahren gering. Es ist höchste Zeit, dass die Bundesregierung handelt und konkrete Lösungen für die Alltagssorgen der Menschen liefert“, so Pop.
Die Finanzverwaltung NRW verfügt zudem über eigene Content-Creator, die regelmäßig Inhalte für die Social-Media-Kanäle der Behörde auf LinkedIn, Facebook, Instagram sowie X erstellen. Damit zeigt die Verwaltung, dass sie nicht nur informiert, sondern auch selbst die Möglichkeiten der digitalen Kommunikation aktiv nutzt.
Verbraucherreport 2025 – Die Lage der Verbraucher:innen
Wie gut fühlen sich Verbraucher:innen in ihrem alltäglichen Leben geschützt? Welche Probleme und Sorgen treiben sie um? Antworten auf diese Fragen gibt der jährliche Verbraucherreport des Verbraucherzentrale Bundesverbands.
„Shopping 4.0 – Wer zahlt den Preis?”
Beim Deutschen Verbrauchertag 2025 diskutiert die Verbraucherzentrale mit Politik, Wirtschaft und Wissenschaft darüber, wie Verbraucher:innen beim Online-Shopping besser geschützt werden können. Programm und weitere Informationen finden Sie unter: https://www.vzbv.de/termine/deutscher-verbrauchertag-2025.
Pressemitteilung der Verbraucherzentrale: Online-Shopping: Mehrheit beklagt mangelnden Schutz vor unseriösen Anbietern
Alle wichtigen Steuer-Infos für Influencer und Content-Creator jetzt online
09/2025 - Wer in sozialen Netzwerken wie Instagram, TikTok, YouTube oder Twitch aktiv ist und damit Einnahmen erzielt, sollte auch die steuerlichen Pflichten von Anfang an im Blick haben. Die Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalen hat dazu jetzt alle wichtigen Informationen gebündelt und auf einer zentralen Website veröffentlicht: finanzamt.nrw.de/Influencer.
Die neue Informationsseite liefert praxisnahe Hinweise zu allen steuerlich relevanten Themen: von der Einkommen- und Gewerbesteuer über die Umsatzsteuer bis hin zu den verschiedenen Arten von Einnahmen wie Sponsorings, Produktplatzierungen, Merchandise-Verkäufen oder Preisgeldern. Sie richtet sich sowohl an Einsteigerinnen und Einsteiger als auch an bereits im Business aktive Content-Creator. Ziel ist es, die Branche frühzeitig zu unterstützen, Rechtssicherheit zu schaffen und so einen erfolgreichen Karriereweg zu begleiten.
Minister der Finanzen Dr. Marcus Optendrenk: „Influencer und Content-Creator sind eine wachsende und wichtige Branche. Uns geht es darum, zu informieren, aufzuklären und Partner für die Menschen zu sein, die hier ihre berufliche Zukunft aufbauen oder bereits fest etabliert sind. Mit der neuen Website bündeln wir alle steuerlichen Informationen an einer zentralen Stelle, leicht verständlich und jederzeit abrufbar.“
Die Informationsseite enthält kompakte Texte, Erklärvideos, Links zu weiterführenden Angeboten sowie praktische Hinweise zur Zusammenarbeit mit dem Finanzamt. Neben den speziellen Inhalten für Influencer liefert die Website finanzamt.nrw.de auch umfassende Informationen zu allen weiteren steuerlichen Anliegen von Privatpersonen und Unternehmen.
Die Finanzverwaltung NRW verfügt zudem über eigene Content-Creator, die regelmäßig Inhalte für die Social-Media-Kanäle der Behörde auf LinkedIn, Facebook, Instagram sowie X erstellen. Damit zeigt die Verwaltung, dass sie nicht nur informiert, sondern auch selbst die Möglichkeiten der digitalen Kommunikation aktiv nutzt.
Hintergrund
Einnahmen aus Influencer-Tätigkeiten, wie Geldbeträge oder Sachleistungen wie Produkte, Gutscheine oder Geschenke sind steuerpflichtig. Die Website der Finanzverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen erklärt Schritt für Schritt, welche Pflichten bestehen, wie Steuerarten voneinander abzugrenzen sind und welche Fristen eingehalten werden müssen.
Pressemitteilung der Landesregierung NRW: Alle wichtigen Steuer-Infos für Influencer und Content-Creator jetzt online
Support für Windows 10 endet
09/2025 - Stiftung Warentest zeigt Wege aus der Windows-10-Falle - Wer auf seinem Rechner immer noch mit Windows 10 arbeitet, muss sich bis Oktober eine Alternative überlegen: Dann stellt Microsoft den Support ein und massive Sicherheitslücken drohen. Die Stiftung Warentest zeigt, welche Möglichkeiten PC-Nutzerinnern und -Nutzer haben – von alternativen Betriebssystemen bis zu neuen Laptops.
Neuer Laptop: gute Geräte für unter 700 Euro
Wer sich einen neuen Laptop anschaffen will, für den bietet die Testdatenbank der Stiftung Warentest mehr als 50 aktuell erhältliche Modelle aus allen Preisklassen und Bauformen. „In unserer Datenbank erfüllen alle Rechner die von uns empfohlene Mindestausstattung“, erklärt Georg Dahm, journalistischer Leiter des Teams Digitales und Technik bei der Stiftung Warentest. „Gute Modelle gibt es bereits ab 664 Euro.“
Refurbished-Laptop: nachhaltig und günstig
Eine nachhaltige Alternative sind generalüberholte Laptops. Die Stiftung Warentest hat acht Online-Shops für „Refurbished“-Geräte geprüft. „Vier Shops erhielten ein gutes Qualitätsurteil. Bei ihnen stimmen die Qualität der Laptops und auch der Service“, so Georg Dahm. „Im Vergleich zu einem vergleichbaren Neugerät konnten wir bis zu 1 200 Euro pro Rechner sparen“. Käuferinnen und Käufer haben ein 14-tägiges Widerrufsrecht und können die gebrauchten Rechner zu Hause prüfen; der Testbericht erklärt, worauf es dabei ankommt.
Betriebssystem wechseln: kostenlose Alternativen
Wer dagegen seinen alten Rechner weiterverwenden möchte, kann auf alternative Betriebssysteme umsteigen. „Wer mit Windows klarkommt, wird sich auch in Chrome OS Flex oder Linux Mint schnell zurechtfinden“, sagt Georg Dahm. ChromeOS Flex eignet sich für Nutzerinnen und Nutzer, die hauptsächlich im Internet surfen – es benötigt aber ein Google-Konto und läuft überwiegend browserbasiert. Linux Mint bietet mehr Funktionen, Unabhängigkeit von Tech-Konzernen und umfangreiche Software – darunter viele Angebote, die man auch von Windows kennt. Für andere, wie Adobe Photoshop oder Microsoft Office, gibt es kostenlose Alternativen. Beide Systeme lassen sich risikolos per USB-Stick testen..
Übergangslösung nutzen
Als Übergangslösung bietet Microsoft Privatnutzern eine einjährige Support-Verlängerung für Windows 10 an. Sie kostet etwa 30 Euro. Ausführliche Testergebnisse, Kaufberatung und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Windows-Alternativen finden Interessierte in der September-Ausgabe der Stiftung Warentest sowie online unter www.test.de.
Pressemitteilung der Stiftung Warentest: Support für Windows 10 endetStiftung Warentest zeigt Wege aus der Windows-10-Falle
Konjunktur- und Einkommenserwartung verbessern sich
08/2025 - Die Verbraucherstimmung in Deutschland präsentiert sich im Juni ohne klaren Trend. Die Konjunktur- und Einkommenserwartungen verbessern sich. Im Gegensatz dazu bleibt die Anschaffungsneigung nahezu unverändert und die Sparneigung nimmt zu. Der Konsumklima-Indikator prognostiziert für Juli 2025 im Vergleich zum Vormonat (revidiert -20,0 Zähler) einen leichten Rückgang um 0,3 Zähler auf -20,3 Punkte. Dies zeigen die aktuellen Ergebnisse des GfK Konsumklimas powered by NIM. Es wird seit Oktober 2023 gemeinsam von NIQ/GfK und dem Nürnberg Institut für Marktentscheidungen (NIM), Gründer der GfK, herausgegeben.
Vor allem eine steigende Sparneigung verhindert, dass das Konsumklima seine Erholung fortsetzen kann. Der Sparindikator steigt im Juni um 3,9 Zähler und klettert mit aktuell 13,9 Punkten auf den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr. Im April 2024 wurden 14,9 Zähler gemessen.
„Nach zuvor drei Anstiegen in Folge muss das Konsumklima damit wieder einen kleinen Dämpfer hinnehmen,“ erklärt Rolf Bürkl, Konsumexperte beim NIM. „Dafür ist vor allem die gestiegene Sparneigung verantwortlich, die die positiven Impulse durch verbesserte Einkommensaussichten derzeit konterkariert. Eine hohe Sparneigung der Konsumenten ist auch Ausdruck ihrer anhaltenden Verunsicherung und damit fehlender Planungssicherheit. Letztere ist für die Konsumenten vor allem für größere Anschaffungen bzw. Ausgaben entscheidend. Deshalb muss auch die Anschaffungsneigung in diesem Monat kleine Einbußen hinnehmen.“
Die Einkommenserwartungen setzen ihre Erholung fort
Die Einkommensaussichten der deutschen Verbraucher bleiben auch im Juni klar auf Erholungskurs. Der Einkommensindikator steigt zum vierten Mal in Folge. Nach einem Plus von 2,4 Zählern klettert er auf einen Wert von 12,8 Punkten. Gegenüber dem Vorjahr steht damit ein kleines Plus von 4,6 Punkten zu Buche.
Die optimistischen Aussichten hinsichtlich der finanziellen Einkommensentwicklung stützen sich in erster Linie auf die zuletzt guten Tarifabschlüsse, wie z.B. im öffentlichen Dienst, in Verbindung mit einer moderaten Inflationsrate. Dies führt zu realen Kaufkraftzuwächsen für einen großen Teil der Beschäftigten. Auch die Rentner können profitieren – ihre gesetzlichen Altersbezüge werden zum 1. Juli 2025 um 3,74 Prozent steigen.
Die Anschaffungsneigung bleibt verhalten
Im Gegensatz zu den verbesserten Einkommensaussichten bleibt die Anschaffungsneigung auch im Juni eher verhalten. Der Indikator gewinnt mit einem Plus von 0,2 Zählern nur sehr bescheiden hinzu und weist gegenwärtig -6,2 Punkte auf.
Damit kann die Anschaffungsneigung den zweiten Monat in Folge nicht von dem deutlichen Anstieg der Einkommenserwartung profitieren. Die Verunsicherung durch die nach wie vor unberechenbare Politik der US-Regierung, besonders zu Fragen der Zoll- und Handelspolitik, sorgt dafür, dass die deutschen Verbraucher zurückhaltend bleiben und abwarten.
Die Konjunkturerwartungen klettern auf den höchsten Wert seit Februar 2022
Aus Sicht der Verbraucher verstärken sich die Signale für eine Erholung der deutschen Wirtschaft in den kommenden Monaten. Der Konjunkturindikator klettert nach einem deutlichen Plus von sieben Zählern auf 20,1 Punkte. Dies ist der höchste Wert seit Ausbruch des Ukraine-Krieges. Im Februar 2022 wurden 24,1 Punkte gemessen.
Viele Konsumenten gehen offenbar davon aus, dass sich die Konjunktur im weiteren Verlauf des Jahres 2025 erholen wird. Dieser Optimismus wird durch die kürzlich veröffentlichten Konjunkturprognosen der wichtigsten deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute gestützt. Demnach gehen diese davon aus, dass in diesem Jahr ein kleiner Zuwachs des Bruttoinlandsproduktes (BIP) von etwa 0,3 Prozent möglich ist. Der wachsende Optimismus gründet sich in erster Linie in den verabschiedeten Konjunkturpaketen für Verteidigung und Infrastruktur, die bereits in der zweiten Jahreshälfte 2025 ihre Wirkung entfalten sollen.
Pressemitteilung der GfK: Konsumklima: Konjunktur- und Einkommenserwartung verbessern sich
Kinder und Jugendliche online besser schützen
07/2025 -Stellungnahme des Verbraucherzentrale Bundesverbands zu EU-Leitlinien für Online-Plattformen zum Schutz von Minderjährigen - Kinder und Jugendliche sollen Online-Plattformen unbeschwert nutzen können, um sich zu vernetzen, kreativ auszudrücken und an der digitalen Welt teilzuhaben. Doch aktuell sind minderjährige Nutzer:innen auf vielen Online-Plattformen erheblichen Risiken ausgesetzt – mit potenziell gravierenden Folgen für ihr Wohlbefinden und ihre Entwicklung. Die Europäische Kommission hat neue Leitlinien für Online-Plattformen zum Schutz von Minderjährigen veröffentlicht. Der Verbraucherzentrale Bundesverband sieht Nachbesserungsbedarf. Der Schutz von Kindern und Jugendlichen muss oberste Priorität haben.
„Kinder und Jugendliche verbringen täglich sehr viel Zeit auf Online-Plattformen. Dabei sind gerade sie schnell mit Inhalten konfrontiert, die nicht altersgerecht sind. Ihre mentale und physische Gesundheit muss über dem Profitinteresse der Online-Plattformen stehen“, sagt Ramona Pop, Vorständin des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv).
„Eine reine Altersüberprüfung führt noch nicht zu mehr Sicherheit. Die Gestaltung und Grundeinstellungen der Plattformen müssen von vornherein verbraucherfreundlich sein. Jegliche manipulative Designelemente gehören verboten. So müssen endloses Scrollen, die automatische Wiedergabe von Inhalten und Push-Benachrichtigungen deaktiviert sein“, sagt Pop.
Auf Online-Plattformen sind verbindlichere und wirksamere Vorgaben zum Schutz minderjähriger Nutzer:innen notwendig. Auf Engagement basierende Empfehlungssysteme sollten ausgeschaltet sein, Accounts von vornherein auf privat gestellt und der Einsatz manipulativer Designelemente verboten sein. Die bislang vorausgesetzte Altersverifikation hält der Verbraucherzentrale Bundesverband allein nicht für ausreichend, da sie Datenschutzrisiken birgt und leicht umgangen werden kann.
Hintergrund
Mit dem Digital Services Act (DSA) hat die Europäische Union einen neuen Rechtsrahmen geschaffen, der die Sicherheit und Rechte von Nutzer:innen im digitalen Raum stärken soll. Besonders Kinder und Jugendliche gelten dabei als besonders schützenswerte Zielgruppe. Artikel 28 des DSA verpflichtet Online-Plattformen, gezielte Maßnahmen zu ergreifen, um Minderjährige vor Risiken wie Manipulation und gefährdenden Inhalten zu schützen. Dazu gehören etwa Cybergrooming, Abhängigkeit, Konfrontation mit verstörenden Inhalten oder Kostenfallen. Die Europäische Kommission hat hierzu Anfang Mai Leitlinien veröffentlicht, die diese Anforderungen konkretisieren sollen.
Download: Protection of Minors Online (in English)
Pressemitteilung der Verbraucherzentralw Bundesverband (vbz): Kinder und Jugendliche online besser schützen: vzbv fordert strengere Regeln für Plattformen
Datenschutz-Urteil: Google hat Griff nach Nutzerdaten unzulässig vereinfacht
06/2025 - Verstoß bei der Google-Konto-Registrierung: LG Berlin gibt Klage des Verbraucherzentrale Bundesverbands gegen Google Ireland Ltd. statt - Mit einer einzigen Registrierung sollten Verbraucher:innen Google erlauben, ihre Daten auf 70 Diensten zu verarbeiten. Eine vermeintliche Einwilligungserklärung bei der Registrierung für ein Google-Konto verstieß gegen die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und war unwirksam. Das hat das Landgericht Berlin nach einer Klage des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) entschieden. Die Einwilligung beruhe nicht auf einer freiwilligen und informierten Entscheidung der Nutzer:innen.
„Verbraucher:innen müssen wissen, wofür Google ihre Daten verarbeitet, und über die Verarbeitung ihrer Daten frei entscheiden können“, sagt Heiko Dünkel, Leiter Team Rechtsdurchsetzung im vzbv. „Datenschutz ist auch Verbraucherschutz. Umso wichtiger ist, dass wir Verstöße gegen die DSGVO gerichtlich stoppen lassen können.“
Umfassende Datennutzung für mehr als 70 Dienste
Google bietet mehr als 70 Dienste an, unter anderem die Google-Suche und YouTube. Im Rahmen der Kontoregistrierung wollte sich Google für alle Dienste die Einwilligung einholen, unter anderem sogenannte „Web- & App-Aktivitäten“ zu speichern. Dies umfasste alle Nutzeraktivitäten
- auf Google-Websites,
- in Google-Apps,
- in Google-Diensten,
- bei den Suchanfragen,
- bei der Interaktion mit Google-Partnern,
- zum eigenen Standort,
- bei der Sprache.
Zudem sollte auch die Speicherung der auf YouTube angesehenen Videos sowie das Einverständnis zur personalisierten Werbung von der Einwilligung umfasst sein.
Diese von Google im Jahr 2022 eingeholte Einwilligung zur Datenverarbeitung entsprach nach Ansicht des vzbv jedoch nicht der DSGVO. Das betraf die Express-Personalisierung genauso wie die manuelle Personalisierung.
Bei der Express-Personalisierung mussten Nutzer:innen entweder sämtlichen Datennutzungen zustimmen oder den Vorgang abbrechen. Bei der manuellen Personalisierung waren einzelne Datennutzungen ablehnbar. Dies galt jedoch nicht für die Nutzung des Standorts in Deutschland.
Verstoß gegen Datenschutzgrundverordnung
Das Landgericht Berlin schloss sich der Auffassung des vzbv an, dass die Einwilligungserklärung unwirksam war und gegen die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verstieß. Danach müsse die Einwilligung in die Nutzung personenbezogener Daten freiwillig sein. An der Freiwilligkeit fehle es jedenfalls, weil die Datenverarbeitung personenbezogener Daten nicht komplett abgelehnt werden kann.
Gericht kritisiert Intransparenz
Das Gericht beanstandete außerdem die mangelhaften Informationen zur vorgesehenen Datenverarbeitung. Es fehle schon deshalb an Transparenz, weil Google weder über die einzelnen Google-Dienste noch Google Apps, Google-Websites oder Google-Partner aufkläre, für welche die Daten verwendet werden sollen. Die Reichweite der Einwilligung sei den Betroffenen daher völlig unbekannt. Dass die Angabe der einzelnen Dienste aufgrund ihrer Fülle zu einer unübersichtlichen Darstellung führen würde, deute „eindrücklich darauf hin, dass die Beklagte den Umfang der Einwilligung in erheblichem Maße überspannt hat.“
Voreinstellung von Speicherfristen unzulässig
Das Gericht verurteilte Google außerdem dazu, es zu unterlassen, Nutzer:innen in den Voreinstellungen nicht auch eine Speicherfrist der Daten von drei Monaten anzubieten. Ein Löschen der Daten nach drei Monaten konnte von den Nutzer:innen nur nachträglich eingestellt werden. Das Gericht sah darin einen Verstoß gegen Art. 25 Abs. 2 S. 1 DSGVO (sog. „privacy by default“). Die Vorschrift verlange, dass Nutzer:innen keine Änderungen an den Einstellungen vornehmen müssen, um eine möglichst „datensparsame“ Verarbeitung zu erreichen.
Urteil des LG Berlin II vom 25.03.2025, Az. 15 O 472/22, nicht rechtskräftig. Google hat gegen das Urteil Berufung eingelegt (Kammergericht Berlin, Aktenzeichen: 5 U 45/24).
Download: Urteil des Landgericht Berlin II vom 25.03.2025; Az. 15 O 472/22 – nicht rechtskräftig
Pressemitteilung der Verbraucherzentralw Bundesverband (vbz): Datenschutz-Urteil: Google hat Griff nach Nutzerdaten unzulässig vereinfacht
Vergleich: Prämiensparer:innen der Stadtsparkasse München erhalten Zinsnachzahlung
06/2025 -Prämiensparer:innen erhielten jahrelang zu wenig Zinsen für ihre Ersparnisse. Deswegen reichte die Verbraucherzentrale zahlreiche Klagen gegen Sparkassen ein. Im Fall der Stadtsparkasse München haben beide Seiten nun vor dem Bayerischen Obersten Landesgericht einen Vergleich geschlossen. Rund 2.400 Kund:innen erhalten dadurch nachträglich Geld überwiesen, häufig liegen die Beträge im vierstelligen Bereich. Die Betroffenen hatten sich der Musterfeststellungsklage des Verbraucherzentrale Bundesverbands angeschlossen.
„Rund 2.400 Prämiensparer:innen bleiben von einer längeren gerichtlichen Hängepartie verschont und erhalten stattdessen unkompliziert Geld nachgezahlt. Angesichts der Inflation und des höheren Alters vieler Prämiensparer:innen ist das abgekürzte Verfahren in doppelter Hinsicht ein Gewinn für viele Menschen. Wir haben mit der Stadtsparkasse München einen fairen Vergleich für Prämiensparer:innen aushandeln können“, sagt Sebastian Reiling, Referent Team Sammelklagen im Verbraucherzentrale Bundesverband.
Nachzahlung orientiert sich am BGH-Urteil zu Prämiensparverträgen
Mit der Klage gegen die Stadtsparkasse München wollte der vzbv feststellen lassen, wie falsch berechnete Zinsen zu Prämiensparverträgen neu zu berechnen sind. Im Juli 2024 hatte zwischenzeitlich der Bundesgerichtshof (BGH) zu zwei parallelen Klagen der Verbraucherzentrale einen möglichen Maßstab zur Nachberechnung bestätigt. Der nun im Vergleich mit der Stadtsparkasse München festgelegte Ansatz liegt knapp unter dem vom BGH genannten Maßstab.
Betroffene Prämiensparer:innen, die sich der Musterfeststellungsklage des vzbv angeschlossen hatten, erhalten zwischen 0,85 und 8,15 Prozent ihres am Ende angesparten Guthabens nachgezahlt. Entscheidend für die Höhe des Prozentsatzes ist, wann die erste Sparrate gezahlt wurde.
Das Bayerische Oberste Landesgericht hat den Vergleich auf Angemessenheit geprüft und genehmigt.
Pressemitteilung des OLG Bayern: Vergleich im Musterfeststellungsverfahren zu Prämiensparverträgen gegen die Stadtsparkasse München
Pressemitteilung der Verbraucherzentralw Bundesverband (vbz): Vergleich: Prämiensparer:innen der Stadtsparkasse München erhalten Zinsnachzahlung
Nur wenige Hunde-OP-Versicherungen sind empfehlenswert
05/2025 -Eine Operation bei einem Hund kann schnell mehrere Tausend Euro kosten. Eine Hunde-OP-Versicherung ist da eine gute Sache. Doch rund drei Viertel der Tarife im Test kann die Stiftung Warentest nicht empfehlen.
7260 Einzelprüfungen hat das Team um Testleiterin Claudia Bassarak durchgeführt – 60 Prüfpunkte für jede der 121 getesteten Hunde-OP-Tarifvarianten. „Rund ein Viertel der Tarife ist gut oder sehr gut. Rund drei Viertel können wir nicht empfehlen“, sagt sie. „Unverzichtbar ist, dass die Versicherungssumme nicht gedeckelt ist, wie zum Beispiel bei manchen Tarifen auf 2500 Euro oder 5000 Euro. Teure OPs sind sonst nicht vollständig abgedeckt.“ Alle sehr guten oder guten Tarife im Test haben eine unbegrenzte Versicherungssumme.
Sehr gute Policen für einen jungen Beispielhund kosten zwischen 216 Euro und 403 Euro im Jahr. Die Beitragshöhe hängt wesentlich vom Alter des Hundes und seiner Rasse ab. Die Expertin rät: „Schließen Sie die Versicherung so früh wie möglich ab. Je älter Ihr Hund wird, desto wahrscheinlicher werden Erkrankungen. Es wird dann schwieriger, einen guten Tarif zu finden. Viele Anbieter schließen Vorerkrankungen aus oder versichern das Tier erst gar nicht.“
Einige Tarife im Test fallen positiv auf: Sie verzichten nach dem dritten Versicherungsjahr auf bestimmte Kündigungsrechte – sowohl auf ihr Recht zur ordentlichen Kündigung als auch auf ihr außerordentliches Kündigungsrecht nach einem Versicherungsfall. Wer also seine Beiträge regelmäßig zahlt, ist ab dem vierten Jahr deutlich besser vor Kündigungen geschützt als bei anderen Anbietern.
Welche Tarife gut oder sogar sehr gut abschneiden und wie Hundebesitzer für ihr Tier den passenden Tarif finden, steht in der Mai-Ausgabe von Stiftung Warentest Finanzen und unter www.test.de/hunde-op-versicherung.
Pressemitteilung der Stiftung Warentest: Nur wenige Hunde-OP-Versicherungen sind empfehlenswert
Fitnessstudio-Urteil: McFIT muss Preise für Verbraucher:innen richtig angeben
05/2025 -LG Bamberg gibt Klage des vzbv gegen die RSG Group GmbH, Betreiberin der McFIT-Fitnessstudios, statt - 24,90 Euro im Monat sollte die Mitgliedschaft bei McFIT im Tarif Classic mit einer Mindestvertragslaufzeit von zwölf Monaten kosten. So stand es auf der Internetseite der Fitnessstudio-Kette. Doch mit Aktivierungsgebühr, Service- und Trainingspauschalen mussten Mitglieder im Schnitt 30,65 Euro pro Monat zahlen. Der Gesamtpreis von 387,80 Euro während der Mindestvertragslaufzeit fehlte. Die Preisangaben von McFIT waren mangelhaft, entschied das Landgericht (LG) Bamberg nach einer Klage des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv).
„Extrakosten herauszurechnen ist eine verbreitete Methode, um Verbraucher:innen mit vermeintlich kleinen Preisen zu locken. Die Preise, die McFIT angibt, müssen richtig sein“, sagt Jana Brockfeld, Rechtsreferentin beim vzbv. „Das Gericht hat klargestellt, dass absehbare Zusatzkosten in den Monatspreis der beworbenen Mitgliedstarife einzurechnen sind. Verbraucher:innen müssen ihre finanziellen Belastungen, die mit dem Abschluss längerfristiger Verträge einhergehen, klar erkennen können.“
Lückenhafte Preisangaben
McFIT hatte im Internet mit Monatspreisen von 24,90 Euro für den Tarif Classic und 34,90 Euro für den Premium Tarif mit einer Mindestvertragslaufzeit von jeweils zwölf Monaten geworben. Nicht darin enthalten waren allerdings die einmalige Aktivierungsgebühr von 39 Euro und die halbjährliche Service- und Trainingspauschale von 15 Euro. Während der Erstlaufzeit des Vertrags kamen somit Zusatzgebühren von 69 Euro hinzu, was mindestens zwei, im Tarif Classic sogar fast drei Monatsbeiträgen entspricht. Wie viel die Mitgliedschaft während der angebotenen Laufzeit von zwölf Monaten insgesamt kostet, gab das Unternehmen nicht an.
Verstoß gegen die Preisangabenverordnung
Das Landgericht Bamberg folgte der Auffassung des vzbv, dass die Betreiberin der McFIT-Studios gegen die Preisangabenverordnung verstieß. Diese verpflichtet Anbieter zur Angabe des Gesamtpreises – einschließlich aller unvermeidbarer und vorhersehbarer Preisbestandteile. Sowohl die Aktivierungsgebühr als auch die Trainings- und Servicegebühr stellten einen festen und bereits im Voraus bekannten Preisbestandteil dar. McFIT hätte daher nach Angaben des Gerichts auf seiner Internetseite den Gesamtpreis für die Mindestvertragslaufzeit angeben und die Zusatzgebühren darin einrechnen müssen.
Das Gericht kam außerdem zu dem Schluss, dass das Unternehmen die Monatspreise nicht korrekt angegeben hatte, da es Zusatzkosten bewusst nicht berücksichtigt habe. Die Aktivierungsgebühr und die Trainings- und Servicepauschale erreichten laut Gericht einen beachtlichen Anteil am zu zahlenden Betrag und seien als sonstige Preisbestandteile in den Monatsbeitrag einzubeziehen.
Durch das Fehlen eines Gesamtpreises und die falsche Angabe des Monatspreises werde ein Vergleich der Anbieter erheblich erschwert. Um einen Vergleich anstellen zu können, müssten Kund:innen zunächst die jeweiligen Preise selbst ermitteln. Dass andere Mitbewerber womöglich auf die gleiche Weise unlauter handeln, rechtfertige den Rechtsverstoß nicht.
Downloads
Urteil des Landgericht Bamberg vom 21.02.2025; Az. 1 HK O 27/24 - nicht rechtskräftig .
Pressemitteilung der vbz: Fitnessstudio-Urteil: McFIT muss Preise für Verbraucher:innen richtig angeben
Drei Geldhäuser sind streng nachhaltig - Geld auf die grüne Bank schieben
04/2025 -Girokonto, Zinsanlagen, Fonds, Kredite: Alle Geldgeschäfte lassen sich auch nachhaltig gestalten – grüne Banken bieten alle typischen Geldgeschäfte an. Von 117 befragten Banken bewertet die Stiftung Warentest 12 Geldhäuser als „nachhaltig“, drei sogar als „streng nachhaltig“.
Die drei Banken mit den strengsten Nachhaltigkeitskriterien im Test sind GLS Bank, KD-Bank und Umweltbank. „Diese Banken sind streng nachhaltig, weil sie etwa Kredite ausschließlich für soziale und ökologische Projekte vergeben und transparent darüber berichten“, sagt Testleiter Bostjan Krisper.
Aktuelle Vorschläge der Europäischen Kommission zur digitalen Brieftasche widersprechen den Interessen der Verbraucher:innen. Sie machen es Verbraucher:innen schwer, sich einen Überblick darüber zu verschaffen, wie öffentliche Verwaltungen, Unternehmen und andere Akteure ihre Daten und ihre digitale Identität nutzen. So müsste laut aktueller Vorschläge für Verbraucher:innen nicht kenntlich gemacht werden, ob die Datenabfrage rechtlich notwendig ist oder nicht. Der vzbv fordert, dass nur für die Dienstleistung zwingend notwendige Daten von Anbietern abgefragt werden dürfen.
Zwölf weitere Institute stuft die Stiftung Warentest als nachhaltig ein, die zweitbeste Bewertungsstufe. Darunter sind zahlreiche Kirchenbanken, aber auch regionale Genossenschaftsbanken. „Nachhaltige Banken beachten bei Finanzierungen und Anlagen Ausschlusskriterien wie zum Beispiel für Kohle, Atomkraft, Tabak und Waffen“, sagt der Finanzexperte.
Das günstigste nachhaltige Girokonto bietet die Sparda-Bank Hamburg. Es kostet für einen Modellkunden 15 Euro pro Jahr, regelmäßiger Gehaltseingang vorausgesetzt. Das preiswerteste Girokonto unter den Testsiegern gibt es für 40 Euro pro Jahr. Beim Tagesgeld sind derzeit bis zu 3 Prozent bei nachhaltigen Banken möglich. Bei den meisten Banken lassen sich auch grüne ETF besparen
Welche Zinskonditionen, Girokonten, Wertpapierdepots und Serviceangebote alle grünen Banken bieten, zeigt der Test in der April-Ausgabe von Stiftung Warentest Finanzen und unter www.test.de/nachhaltige-banken.
Pressemitteilung der Stiftung Warentest: Geld auf die grüne Bank schieben - Drei Geldhäuser sind streng nachhaltig
Stärkt alle: Pflegeangebote vor Ort verbessern
04/2025 -Vier von fünf pflegebedürftigen Angehörigen werden zu Hause versorgt. Das Problem: Die Nachfrage nach Pflegeleistungen nimmt stetig zu, während das Angebot stagniert oder sogar zurückgeht. Innovative Pflegeprojekte können dazu beitragen, die ambulante Versorgung zu verbessern. Das zeigt ein Gutachten im Auftrag des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv). Die künftige Bundesregierung muss die Kommunen finanziell stärken und mehr Gestaltungsspielraum ermöglichen. Der vzbv schlägt zudem ein bundesweites Online-Portal für Best-Practice-Beispiele in der ambulanten Pflege vor.
„Die neue Bundesregierung muss dafür sorgen, dass der Alltag der Menschen funktioniert. Gute und bezahlbare Pflege gehört dazu. Unser Gutachten zeigt: Bereits kleine Projekte können die Pflegeversorgung verbessern. Die Politik muss erfolgreiche Projekte bekannter machen. Wir schlagen ein bundesweites Online-Portal vor, das innovative Pflegeprojekte gebündelt darstellt. Kommunen können sich so über Best-Practice-Beispiele informieren und voneinander lernen“, so Thomas Moormann, Leiter des Teams Gesundheit und Pflege im vzbv.
Der vzbv fordert den Bund auf, die Kommunen im Pflegebereich finanziell zu stärken und ihnen mehr Handlungsspielraum zu geben. Das erleichtert es den Kommunen, innovative Pflegekonzepte auf den Weg zu bringen.
Innovationen vor Ort: Von Kommunen lernen
Das vom vzbv beauftragte Gutachten zeigt, dass bereits innovative kommunale Projekte existieren, welche die Pflegesituation vor Ort stärken und verbessern. Die Ideen der Kommunen sind vielfältig: Ein Pflegedienst in Osnabrück konzentriert sich auf die Versorgung eines gesamten Quartiers. Das reduziert Kosten und Fahrzeiten und schafft mehr Raum für soziale Interaktion.
In einem anderen Beispiel vernetzt und koordiniert eine Kommune verschiedene Anbieter von Pflegeleistungen, Haushaltshilfen und sozialer Unterstützung. So müssen Pflegebedürftige einzelne Leistungen nicht mehr individuell beantragen und abrechnen. Stattdessen wird ein Stundentarif vereinbart. Bürokratische Anträge entfallen – das entlastet auch die Pflegedienste.
In der Stadt Riedlingen wurde eine Seniorengenossenschaft gegründet. Deren Mitglieder unterstützen Pflegebedürftige aus der Genossenschaft – beispielsweise beim Einkaufen, im Haushalt oder beim Arztbesuch. Diese Hilfe können sie sich stundenweise vergüten lassen oder ein Zeitkonto anlegen, von dem im Alter eigene Pflege und Unterstützung abgegolten werden kann. Die Lebensqualität älterer Menschen kann mit diesem Projekt gesteigert werden.
Verbraucher:innen im Alltag stärken
Die Beispiele zeigen: Es gibt bereits wirksame Ansätze, wie die knappen pflegerischen Ressourcen vor Ort neu strukturiert und effizienter genutzt werden können. Neben Innovationen braucht es aus Sicht des vzbv auch eine Reform des Pflegesystems. In den kürzlich abgeschlossenen Sondierungsgesprächen haben sich CDU und SPD sich auf eine „große Pflegereform“ verständigt.
„Gute Pflege wird für immer mehr Menschen zum Luxusgut. Die künftige Bundesregierung muss deutlich mehr Geld in die Pflege stecken. Eine umfassende Reform des Pflegesystems ist überfällig. Innovative, kommunale Lösungen sind hierbei ein entscheidender Baustein“, so Moormann.
Download
Kurzpapier: Innovationen in der häuslichen Pflege
Pressemitteilung der Verbraucherzentrale: Stärkt alle: Pflegeangebote vor Ort verbessern
Digitale Identität: Verbraucher:innen müssen digitalen Brieftaschen vertrauen können
03/2025 -Mietverträge abschließen, Wohnung ummelden oder einen neuen Reisepass beantragen: Geschäftsabschlüsse und Behördengänge werden immer digitaler. Damit wird es immer wichtiger, dass sich Verbraucher:innen sicher online ausweisen können. Helfen soll dabei künftig eine digitale Brieftasche, in der Ausweisdokumente digital hinterlegt werden können. Der Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) hat ein Gutachten beauftragt, wie eine verbraucherfreundliche digitale Brieftasche ausgestaltet sein sollte. Bei privatwirtschaftlichen Anbietern muss über strikte Auflagen verhindert werden, dass sie ihre Monopolstellung weiter ausbauen.
„Ob Autokauf, Wohnort ummelden oder Urlaubsreise ins Ausland buchen, vieles kann bereits online erledigt werden. Sich unkompliziert digital ausweisen zu können, wird damit immer wichtiger“, sagt Michaela Schröder, Geschäftsbereichsleitung Verbraucherpolitik beim vzbv. „Eine digitale Brieftasche, in der alle wichtigen Dokumente hinterlegt sind, kann viele Prozesse vereinfachen. Gleichzeitig droht die Gefahr des Datenmissbrauchs durch Tracking und Profilbildung. Damit Verbraucher:innen eine digitale Brieftasche bedenkenlos nutzen können, müssen die Daten sparsam erhoben und automatisch die sicherste Einstellung gewählt sein. Nur so kann das erforderliche, hohe Schutzniveau gewährleistet werden und Vertrauen entstehen.“
Datensparsamkeit und sichere Voreinstellungen gefordert
Aktuelle Vorschläge der Europäischen Kommission zur digitalen Brieftasche widersprechen den Interessen der Verbraucher:innen. Sie machen es Verbraucher:innen schwer, sich einen Überblick darüber zu verschaffen, wie öffentliche Verwaltungen, Unternehmen und andere Akteure ihre Daten und ihre digitale Identität nutzen. So müsste laut aktueller Vorschläge für Verbraucher:innen nicht kenntlich gemacht werden, ob die Datenabfrage rechtlich notwendig ist oder nicht. Der vzbv fordert, dass nur für die Dienstleistung zwingend notwendige Daten von Anbietern abgefragt werden dürfen.
Aus Sicht des vzbv muss es privatwirtschaftlichen Anbietern verboten werden, Daten aus der digitalen Brieftasche für ihr übriges Geschäft zu verwenden. Insbesondere die Verknüpfung der Daten mit amtlichen Dokumenten muss verhindert werden.
„Die digitale Brieftasche darf nicht dazu führen, dass private Anbieter wie Google, Amazon oder Apple ihre Monopolstellungen weiter ausbauen. Nutzer:innen dürfen nicht dazu gedrängt werden, Produkte oder Dienstleistungen des jeweiligen Brieftaschen-Herausgebers zu kaufen oder zu nutzen“, sagt Schröder. Zudem könnten Verbraucher:innen dazu verleitet oder faktisch gezwungen werden, mehr Daten mit den Digitalkonzernen zu teilen. Beispielsweise, wenn die digitale Brieftasche dieses Unternehmens in ein mobiles Betriebssystem eingebettet ist, das mehrere Dienste miteinander verbindet.
Gemischte Resonanz von Verbraucher:innen
Die Verwendung einer digitalen Brieftasche polarisiert: Laut einer Internet-repräsentativen Online-Befragung von eye square im Auftrag des vzbv würden 44 Prozent der Befragten ihren Personalausweis oder ihren Führerschein in einer digitalen Brieftasche hinterlegen, gut ein Drittel (34 Prozent) würde dies nicht tun. Gut jede:r Fünfte (22 Prozent) ist sich unschlüssig.
„Die Verbraucher:innen müssen der Technologie vertrauen, damit die Vorteile der digitalen Brieftasche zum Tragen kommen können“, sagt Schröder.
HIntergrund
Bis Herbst 2026 sind alle EU-Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, ihren Bürger:innen digitale Brieftaschen bereitzustellen, in denen Dokumente wie beispielsweise der Personalausweis oder der Führerschein in elektronischer Form gespeichert werden können – eine European Digital Identity Wallet (EUDI-Brieftasche).
Download
vzbv-Positionspapier | Februar 2025: Digitale Brieftasche verbraucherfreundlich gestalten
Pressemitteilung der Verbraucherzentrale: Digitale Identität: Verbraucher:innen müssen digitalen Brieftaschen vertrauen können
Verunsicherung der Konsumenten bleibt groß
03/2025 -Nach dem Fehlstart im Januar setzt die Verbraucherstimmung im Februar ihren negativen Trend fort. Zwar legen die Konjunkturerwartungen leicht zu, aber die Einkommenserwartungen und die Anschaffungsneigung müssen zum zweiten Mal in Folge Einbußen hinnehmen. Die Sparneigung zeigt hingegen leichte Zugewinne. Folglich geht das Konsumklima für März 2025 im Vergleich zum Vormonat (revidiert -22,6 Zähler) um 2,1 Zähler auf -24,7 Punkte zurück. Dies zeigen die aktuellen Ergebnisse des GfK Konsumklimas powered by NIM. Es wird seit Oktober 2023 gemeinsam von GfK und dem Nürnberg Institut für Marktentscheidungen (NIM), Gründer der GfK, herausgegeben.
Neben der rückläufigen Entwicklung von Einkommenserwartung und Anschaffungsneigung sorgt auch eine steigende Sparneigung für den Rückgang des Konsumklimas: Sie legt um 1,2 Zähler zu und klettert damit auf 9,4 Punkte.
„Die aktuellen Zahlen zeigen keinerlei Anzeichen für eine Erholung der Konsumstimmung in Deutschland. Seit Mitte des vergangenen Jahres stagniert das Konsumklima auf einem niedrigen Niveau. Nach wie vor ist die Verunsicherung unter den Konsumenten groß und die Planungssicherheit fehlt“, erklärt Rolf Bürkl, Konsumexperte beim NIM. „Die zügige Bildung einer neuen Bundesregierung nach den Bundestagswahlen und eine rasche Verabschiedung des Haushaltes für dieses Jahr würden sowohl bei Unternehmen wie auch privaten Haushalten zu mehr Planungssicherheit führen. Damit wären wichtige Rahmenbedingungen gegeben, damit die Verbraucher wieder eher bereit wären, Geld auszugeben und den Konsum zu beleben.“
Die Einkommenserwartungen sinken im Februar auf 13-Monats-Tief
Die Verbraucher schätzen die finanzielle Lage des eigenen Haushaltes für die kommenden 12 Monate zum zweiten Mal in Folge schwächer ein. Der Indikator verliert im Vergleich zum Januar 4,3 Zähler und sinkt damit auf -5,4 Punkte. Ein niedrigerer Wert wurde zuletzt im Januar 2024 gemessen: Damals lag die Einkommenserwartung bei -20 Punkten.
Damit setzt der Einkommensindikator seinen Abwärtstrend, der Mitte des vergangenen Jahres einsetzte, auch im Februar dieses Jahres fort. „Unsere Deep-Dive-Analysen machen die Gründe für diese trüben Einkommensaussichten deutlich. Genannt werden in erster Linie die gestiegenen Preise, eine unsichere wirtschaftliche bzw. politische Lage und die Unzufriedenheit mit der Politik“, fügt Rolf Bürkl an.
Sinkende Einkommenserwartungen und eine steigende Sparneigung bremsen die Anschaffungsneigung
Die Anschaffungsneigung bleibt auch im Februar zwischen rückläufigen Einkommensaussichten und einer steigenden Sparneigung eingeklemmt. Der Indikator verliert 2,7 Zähler und weist aktuell -11,1 Punkte auf. Schlechter war der Wert zuletzt vor 8 Monaten: Im Juni 2024 wurden -13 Punkte gemessen.
Meldungen zu drohenden Werkschließungen, Produktionsverlagerungen ins Ausland sowie Personalabbau in der deutschen Industrie, besonders bei Pkw-Herstellern und deren Zulieferern, führen zu steigenden Sorgen um den Arbeitsplatz. Verschärft wird die Situation noch dadurch, dass aufgrund der schwachen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung die Zahl der Unternehmenspleiten deutlich gestiegen ist und voraussichtlich noch weiter steigen wird. Deshalb werden viele Haushalte weiterhin vorsichtig mit ihren Ausgaben umgehen.
Konjunkturpessimismus sinkt im Februar leicht
Im Gegensatz zur Einkommenserwartung und Anschaffungsneigung schätzen die Deutschen aktuell die Konjunkturaussichten für die kommenden 12 Monate etwas positiver ein. Nach einem Plus von 2,8 Zählern steigt der Konjunkturindikator auf 1,2 Punkte. 2025 droht zu einem weiteren wirtschaftlich schwachen Jahr zu werden. Einige Experten schließen sogar ein drittes Jahr in Folge mit einer rezessiven Entwicklung nicht ganz aus. Das wäre ein Novum in der Geschichte der Bundesrepublik.
Pressemitteilung der NIQ powerd by GfK intelligence: Der Rückgang des Konsumklimas setzt sich fort
Die meisten Rechtsschutzversicherungen überzeugen
02/2025 -Sie hilft dabei, es im Ernstfall auch mit finanzstarken Gegnern aufzunehmen: eine Rechtsschutzversicherung. Die Stiftung Warentest hat 67 Versicherungspakete getestet. Schlecht ist keins, doch die besten Rechtsschutzversicherungen leisten viel mehr als andere.
„Ihr gutes Recht in guten Händen“, „Mit unserer Rechtsschutzversicherung kommen Sie zu Ihrem Recht“, „Damit Sie Ihr gutes Recht bekommen“ – vollmundig klingen die Versprechen der Rechtsschutzversicherer.
Die Stiftung Warentest hat 67 Versicherungspakete für die Lebensbereiche Privat, Beruf und Verkehr unter die Lupe genommen. Halten sie ihre Versprechen ein? Der Testsieger überzeugt mit dem einzigen Sehr gut im Test in fast allen Bereichen. 49 weitere Tarife sind gut, 17 befriedigend. Schlecht schneidet keine Rechtsschutzversicherung ab. Und doch: Die besten Tarife im Test leisten viel mehr als andere.
Rechtsexperte Michael Sittig gibt allerdings zu bedenken: „Es gibt keine Versicherung, die alle Streitigkeiten versichert. Im Kleingedruckten der Versicherungsbedingungen stecken immer Ausschlüsse.“ Die Stiftung Warentest zeigt daher, welchen Mindestschutz jede Rechtsschutzversicherung bietet.
Doch zahlen die Versicherungen tatsächlich, wenn Kundinnen und Kunden sie benötigen? In einer repräsentativen Umfrage hat die Stiftung Warentest mehr als 1500 Personen befragt, die in den vergangenen fünf Jahren einen Fall bei ihrer Rechtsschutzversicherung eingereicht haben.
Die Ergebnisse sind laut Rechtsexperte Sittig erfreulich: „Fast immer haben die Versicherer die Kosten der Rechtsstreitigkeiten vollständig oder zumindest teilweise übernommen. Lediglich in 5 Prozent der Fälle deckte der Versicherer die Kosten nicht. Rund 86 Prozent der Befragten sind zufrieden oder sehr zufrieden mit ihrem Anbieter.“
Welche Anbieter die besten Umfragewerte haben und welche zwei Versicherer negativ auffallen, steht in der Februar-Ausgabe der Zeitschrift Finanztest und unter www.test.de/rechtsschutz.
Pressemitteilung der Stiftung Warentest: Die meisten Rechtsschutzversicherungen überzeugen
Stärken, was alle stärkt: Verbraucherschutz im Supermarkt
02/2025 -vzbv fordert Preisbeobachtungsstelle, Warnhinweise auf Mogelpackungen und Online-Preisportal für Lebensmittelpreise - Die hohen Lebensmittelpreise sind eine große finanzielle Belastung für Verbraucher:innen. Eine aktuelle, repräsentative forsa-Befragung im Auftrag des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) zeigt: Knapp vier von zehn Befragten (39 Prozent) müssen sich aufgrund der gestiegenen Lebensmittelpreise beim Lebensmitteleinkauf einschränken. Der vzbv fordert die künftige Bundesregierung auf, den hohen Lebensmittelpreisen entgegenzuwirken und den Verbraucherschutz im Supermarkt zu stärken.
„Es darf nicht sein, dass eine gesunde Ernährung immer mehr zu einer Frage des Geldbeutels wird. Die Mehrheit der Verbraucher:innen empfindet die derzeitigen Lebensmittelpreise nicht als fair. Die Politik muss hier gegensteuern. Verbraucher:innen müssen sich darauf verlassen können, dass die Politik ihre Alltagssorgen ernst nimmt und Lösungen findet. Starker Verbraucherschutz stärkt uns alle: die Menschen, die Wirtschaft und den Zusammenhalt“, so Michaela Schröder, Geschäftsbereichsleiterin Verbraucherpolitik im vzbv.
Verbraucher:innen empfinden Lebensmittelpreise als unfair
Seit 2020 sind die Lebensmittelpreise um durchschnittlich mehr als 34 Prozent gestiegen (Quelle: Statistisches Bundesamt). Aufgrund der gestiegenen Lebensmittelpreise müssen sich 39 Prozent der Verbraucher:innen beim Lebensmitteleinkauf einschränken. Bei Verbraucher:innen mit einem Haushaltseinkommen bis 2.000 Euro netto sind es sogar 70 Prozent. Die Mehrheit der Verbraucher:innen (61 Prozent) empfindet die derzeitigen Lebensmittelpreise als eher nicht oder gar nicht fair. Das zeigt eine repräsentative forsa-Umfrage im Auftrag des vzbv vom Dezember 2024.
vzbv fordert mehr Transparenz
Ob Lebensmittelpreise zwischen Bauern, Verarbeitern und Händlern fair gebildet werden und Verbraucher:innen am Ende einen fairen Preis zahlen, lässt sich derzeit kaum sagen. In Deutschland ist es bislang nicht nachvollziehbar, wie sich Lebensmittelpreise zusammensetzen. Der vzbv fordert die Einrichtung einer Preisbeobachtungsstelle, die Kosten und Preise entlang der Wertschöpfungskette erfasst. So wären Lebensmittelpreise erstmals nachvollziehbar. Länder wie Spanien und Frankreich haben dieses Instrument bereits etabliert. „Das führt zu mehr Preistransparenz und Fairness“, so Schröder.
Einzelhändler sollten zudem dazu verpflichtet werden, ihre aktuellen Preise für Grundnahrungsmittel an eine einheitliche Online-Plattform zu melden. Das würde Verbraucher:innen einen produktspezifischen Preisvergleich erleichtern. Indirekte Preiserhöhungen durch Mogelpackungen müssen mit einem Warnhinweis gekennzeichnet werden, fordert der vzbv.
„Nicht nachvollziehbare Preise und völlig intransparente Preiserhöhungen beschädigen das Vertrauen der Verbraucher:innen in die Unternehmen der Lebensmittelindustrie und in die Wirtschaft. Damit muss Schluss sein“, so Schröder.
Verbraucherschutz im Supermarkt
In Deutschland verfügen einzelne Konzerne über eine große Macht im Lebensmittelsektor. Sie bestimmen die Preise, entscheiden über das Angebot im Supermarkt und verantworten große Werbekampagnen. Die großen Lebensmitteleinzelhändler haben so entscheidenden Einfluss darauf, was und wie Verbraucher:innen konsumieren.
Verbraucher:innen wollen sich gesund ernähren. Dabei ist ihnen auch Tierwohl und Nachhaltigkeit wichtig. Ob sie tatsächlich nach ihren Vorstellungen einkaufen können, hängt auch von Preis und Angebot im Supermarktregal ab. „Es braucht ein Bekenntnis zu mehr Tierwohl, besserer Kennzeichnung sowie Kontrolle von umwelt- und sozialverträglichen Werbeversprechen“, so Schröder.
Der vzbv fordert von der kommenden Bundesregierung, den Rahmen für eine bezahlbare und gesunde Ernährungsumgebung zu schaffen.
Pressemitteilung der VBZ: Stärken, was alle stärkt: Verbraucherschutz im Supermarkt
Neuer Umsatzrekord in der Black Week 2024 im Bereich technische Konsumgüter
02/2025 -(10. Dezember 2024) – NIQ/GfK veröffentlicht die wichtigsten Ergebnisse der Black Week im Bereich der technischen Konsumgüter. Laut GfK Handelspaneldaten lag die Black Week 2024 mit einem Umsatzvolumen von 156 Millionen Schweizer Franken und einem Plus von rund 3 Prozent klar über dem Vorjahr. Somit wurde sogar die letztjährige Rekordmarke um 4.4 Millionen Schweizer Franken übertroffen.
Trotz eines neuen Rekordumsatzes in der Black Week 2024 lagen die Verkaufszahlen der Vorwochen um -6 Prozent unter dem Vorjahr. Dies deutet klar darauf hin, dass Konsumentinnen und Konsumenten gezielt auf die Promotionsangebote warten. Kumuliert betrachtet dürfte der gesamte November 2024 mit einem Rückgang von -2.5 Prozent abschliessen.
Entwicklung der Teilmärkte im Jahresvergleich
Die höchsten Umsätze wurden 2024 mit Abstand im Bereich IT/Office erzielt. Aufgrund der starken Nachfrage nach Computern, Monitoren und Druckern belief sich der Umsatz auf 53.5 Millionen Schweizer Franken. Besonders gefragt waren Notebooks: Während der Black Week 2024 wurden 31’600 Geräte verkauft, was zu einem Umsatzplus von 12 Prozent führte.
Nach vier Rückgängen in Folge stabilisieren sich die Konjunkturerwartungen der Verbraucher zum Jahresende. Der Indikator gewinnt 3,9 Zähler und kompensiert damit die Verluste aus dem Vormonat. Aktuell weist er 0,3 Punkte auf. Er liegt damit in etwa auf Vorjahresniveau.
Der Bereich Gaming verzeichnete hingegen weiterhin einen Rückgang, was sich negativ auf den Absatz von Desktop-Computern auswirkte. Der Umsatz sank von 6.5 Millionen auf 6 Millionen Schweizer Franken.
Tablets blieben auch in diesem Jahr ein stark nachgefragtes Produktsegment. Der Umsatz konnte von 9.1 Millionen auf 9.3 Millionen Schweizer Franken gesteigert werden, was die anhaltende Beliebtheit dieser Geräte unterstreicht.
Telecom auf Platz zwei
Der Teilmarkt Telecom belegte mit einem Umsatz von 40.5 Millionen Schweizer Franken den zweiten Platz. Allerdings lag der Umsatz bei Smartphones um 3.5 Millionen Franken unter dem Vorjahreswert. Der durchschnittliche Smartphone-Preis blieb mit 600 Franken auf dem hohen Niveau der Black Week 2023 stabil.
Haushaltskleingeräte mit starkem Wachstum
Den dritten Platz sicherte sich der Bereich Haushaltskleingeräte mit einem Umsatz von 33.9 Millionen Franken und einem beachtlichen Wachstum von +25 Prozent. Besonders gefragt waren Körperpflegeprodukte, Kaffeemaschinen und Bodenpflegegeräte. Roboterstaubsauger erwiesen sich als absolute Bestseller: Mit 12’000 verkauften Geräten – viermal mehr als im Vorjahr – wurde ein Umsatz von 7.2 Millionen Franken erzielt. Der Durchschnittspreis stieg markant von 533 Franken auf rund 600 Franken.
TV-Markt stabil
An vierter Stelle rangierten Fernseher mit einem Umsatz von 24.3 Millionen Franken – exakt auf Vorjahresniveau. Der Markt zeigte sich stabil, wobei frühzeitige Promotionen und eine gewisse Marktsättigung das Potenzial begrenzten.
Ausblick
Die Ergebnisse der Black Week zeigen deutlich, dass sich das Kaufverhalten der Konsumentinnen und Konsumenten immer stärker auf Rabattaktionen konzentriert. Entsprechend bleibt die Entwicklung in der Vorweihnachtszeit mit Spannung abzuwarten.
Pressemitteilung der GfK/NIQ: Neuer Umsatzrekord in der Black Week 2024 im Bereich technische Konsumgüter
Konsumklima: Leichte Erholung zum Jahresende, verhaltene Aussichten für 2025
01/2025 -Die Verbraucherstimmung hat sich zum Jahresende leicht erholt. Sowohl die Einkommenserwartungen als auch die Anschaffungsneigung legen im Dezember zu. Zeitgleich sinkt die Sparneigung. Damit steigt das Konsumklima in der Prognose für den Start des neuen Jahres wieder etwas. Für Januar 2025 wird im Vergleich zum Vormonat (revidiert -23,1 Punkte) ein Anstieg von 1,8 Zählern auf -21,3 Punkte prognostiziert. Dies zeigen die aktuellen Ergebnisse des GfK Konsumklimas powered by NIM. Es wird seit Oktober 2023 gemeinsam von GfK und dem Nürnberg Institut für Marktentscheidungen (NIM), Gründer der GfK, herausgegeben.
Neben einer positiven Entwicklung der Einkommenserwartung und Anschaffungsneigung trägt zur leichten Erholung des Konsumklimas auch eine rückläufige Sparneigung bei. Diese geht im Vergleich zum Vormonat um sechs Punkte zurück und liegt aktuell bei 5,9 Punkten.
„Nach dem Einbruch im Vormonat verbessert sich die Konsumstimmung zwar leicht, kann aber die zuvor erlittenen Rückgänge nur teilweise kompensieren. Mit -21,3 Zählern weist das Konsumklima nach wie vor ein sehr niedriges Niveau auf. Rückblickend sehen wir seit Jahresmitte 2024 bestenfalls eine stagnierende Entwicklung,“ erklärt Rolf Bürkl, Konsumexperte beim NIM. „Eine nachhaltige Erholung des Konsumklimas ist nach wie vor nicht in Sicht, dazu ist die Verunsicherung der Konsumenten derzeit noch zu groß. Hauptursache sind die hohen Lebensmittel- und Energiepreise. Zudem werden in vielen Bereichen die Sorgen um die Sicherheit des Arbeitsplatzes größer.“
Konjunkturerwartungen stabilisieren sich auf niedrigem Niveau
Nach vier Rückgängen in Folge stabilisieren sich die Konjunkturerwartungen der Verbraucher zum Jahresende. Der Indikator gewinnt 3,9 Zähler und kompensiert damit die Verluste aus dem Vormonat. Aktuell weist er 0,3 Punkte auf. Er liegt damit in etwa auf Vorjahresniveau.
Zwar ist der Abwärtstrend der Konjunkturstimmung zunächst gestoppt worden, eine nachhaltige konjunkturelle Erholung ist aus Sicht der Konsumenten allerdings noch nicht abzusehen. Auch die Wirtschaftsexperten teilen diese Einschätzung: Die Wachstumsaussichten für 2025 wurden in den jüngsten Prognosen spürbar zurückgenommen. Die Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten für das kommende Jahr allenfalls ein minimales Wachstum. Für 2024 wird eine rote Null vorhergesagt.
Die Einkommenserwartungen erholen sich nach Einbruch im Vormonat
Nach dem starken Einbruch im Vormonat erholen sich die Einkommenserwartungen im Dezember wieder etwas. Mit einem Plus von 4,9 Zählern werden die starken Verluste von über 17 Punkten im November jedoch nur zu einem kleinen Teil kompensiert. Aktuell weist der Einkommensindikator 1,4 Punkte auf.
Trotz des Anstiegs ist das Niveau der Einkommensstimmung noch deutlich niedriger als im Sommer dieses Jahres. Nach unten revidierte Wachstumsprognosen sowie steigende Arbeitslosenzahlen verhindern derzeit eine deutliche Erholung der Einkommenserwartung. Zudem dürften die deutlichen realen Einkommenszuwächse, wie wir sie aus diesem Jahr kennen, im Jahr 2025 der Vergangenheit angehören.
Anschaffungsneigung bleibt auf niedrigem Niveau stabil
Die Anschaffungsneigung setzt auch zum Jahresende ihre stabile Entwicklung fort. Der Indikator gewinnt 0,6 Punkte hinzu und liegt nun bei -5,4 Zählern. Damit können die Verluste aus dem Vormonat etwa zur Hälfte wettgemacht werden. Im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum des Vorjahres ist ein Plus von gut drei Punkten zu verzeichnen. Neben den hohen Preisen für Lebensmittel und Energie verhindert derzeit die zunehmende Sorge um den Job eine bessere Konsumstimmung. Zu dieser Sorge tragen auch die intensiven Diskussionen um Arbeitsplatzabbau, Werksschließungen und Produktionsverlagerungen ins Ausland bei.
Trotz des Anstiegs ist das Niveau der Einkommensstimmung noch deutlich niedriger als im Sommer dieses Jahres. Nach unten revidierte Wachstumsprognosen sowie steigende Arbeitslosenzahlen verhindern derzeit eine deutliche Erholung der Einkommenserwartung. Zudem dürften die deutlichen realen Einkommenszuwächse, wie wir sie aus diesem Jahr kennen, im Jahr 2025 der Vergangenheit angehören.
Der vzbv setzt sich dafür ein, dass die Betreiber von Online-Marktplätzen mehr Verantwortung für das Geschehen auf ihrer Plattform tragen, denn schließlich verdienen sie daran. So sollten sie etwa genauer hinschauen, inwieweit Produktsicherheits- und Verbraucherrechte auf ihrer Plattform eingehalten werden. Außerdem sollten sie prüfen, ob gefährliche Produkte vertrieben werden, bevor diese Verbraucher:innen zugänglich gemacht werden. Tun sie das nicht, sollten sie für Schäden haften.
Pressemitteilung der GfK/NIQ: Konsumklima: Leichte Erholung zum Jahresende, verhaltene Aussichten für 2025
Inkasso: Neue Aufsicht, mehr Verbraucherschutz?
01/2025 -Statement vom Meret Sophie Noll, Referentin im Team Recht und Handel des vzbv: Seit dem 1. Januar 2025 ist das Bundesamt für Justiz die zentrale Aufsichtsstelle über Inkassodienstleister. Für den Verbraucherschutz ist das eine gute Nachricht. Bisher gab es, verteilt über die Bundesländer, 38 verschiedene Aufsichten. Das hat einheitliche Entscheidungen kompliziert gemacht hat. Dazu Meret Sophie Noll, Referentin im Team Recht und Handel des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv):
„Mit der einheitlichen Aufsicht über Inkassounternehmen bietet sich jetzt die Chance, endlich eine hohe Qualität der Aufsichtsaufgaben sicherzustellen. Dafür muss das Bundesamt für Justiz den Beschwerden über Inkassounternehmen schnell und mit einheitlicher Entscheidungspraxis nachgehen. Es ist dabei essenziell, dass die Aufsicht über ausreichende personelle und organisatorische Ressourcen verfügt. Nur so kann sie effektiv arbeiten und frühzeitig auf kritische Entwicklungen im Markt reagieren. Für Verbraucher:innen ist das wichtig, weil sie nun hoffentlich besser vor unseriösen Inkassopraktiken geschützt werden.
Auch Legal-Tech-Unternehmen bieten ihre Dienstleistungen häufig unter einer Inkassolizenz an. Hier ist es Aufgabe des Bundesamts für Justiz, bei den Geschäftsmodellen genau hinzuschauen, um für Verbraucher:innen die Qualität der Angebote sicherzustellen.“
Vor diesen Problemen stehen Verbraucher:innen
- Überhöhte Inkassogebühren: Wer eine Rechnung nicht rechtzeitig bezahlt, erhält oft Post von einem Inkasso-Unternehmen. Das Problem: Betroffene können die Inkassokosten kaum überprüfen. Auch wenn die Forderung an sich berechtigt ist, steht die Höhe der Inkassokosten oft in keinem Verhältnis zum offenen Betrag.
- Problematische Praktiken: Durch bedrohlich klingende Schreiben versuchen die Inkasso-Unternehmen, Druck auf Verbraucher:innen auszuüben. Sind Verbraucher:innen auf eine Ratenzahlungsvereinbarung angewiesen, werden sie zum Teil durch entsprechend vorangekreuzte Felder gedrängt, die Geldforderungen anzuerkennen (Schuldanerkenntnis) oder weitere nachteilige Vereinbarungen zu unterzeichnen.
Der Bundestag und die Bundesregierung sollten…
- die Inkassokosten deckeln. Bei Schulden bis 200 Euro muss eine Kostendeckelung für Inkassogebühren von maximal 15 Euro eingeführt werden.
- die Verknüpfung von Ratenzahlung und Schuldanerkenntnis verbieten. Es braucht ein Verbot, Ratenzahlungsvereinbarungen mit Schuldanerkenntnissen oder anderen nachteiligen Regelungen für Verbraucher:innen zu verknüpfen.
Pressemitteilung der vbz: Inkasso: Neue Aufsicht, mehr Verbraucherschutz?
Inkasso-Check der Verbraucherzentrale
Krankenkassenvergleich 2025 Jetzt noch günstige Krankenkassen mit guten Extras finden
01/2025 -Die Kassenbeiträge steigen. Unser Krankenkassenvergleich zeigt, wie Sie sparen können und dennoch den Schutz optimieren. Vor allem geldwerte Extras zahlen sich aus. Fast alle Krankenkassen haben ihren Beitragssatz zum Jahreswechsel erhöht, auch die großen Kassen Barmer, DAK und TK, die TK etwa von 15,80 Prozent auf 17,05 Prozent.
In unserem Krankenkassenvergleich sind 68 Krankenkassen mit ihren Beitragssätzen und Zusatzleistungen enthalten. Insgesamt sind mehr als 97 Prozent der gesetzlich Versicherten bei diesen Kassen Mitglied oder mitversichert. Wir haben alle Beitragssätze der enthaltenen Kassen ab 1. Januar 2025 in der Datenbank erfasst:
- Erhöhung: 59 Krankenkassen verlangen ab Januar 2025 mehr Beitrag.
- Unverändert: 9 Krankenkassen ließen ihren Beitragssatz zum Jahreswechsel auf gleichem Niveau.
Der Bundestag und die Bundesregierung sollten…
Wechsel ist leicht
Wer unzufrieden mit seiner Kasse ist – etwa weil sie zu teuer geworden ist oder der Service nicht stimmt – sollte über einen Wechsel nachdenken. Ein Wechsel von der derzeit teuersten Krankenkasse zur günstigsten kann bei einem Einkommen von 3 000 Euro brutto monatlich rund 38 Euro oder jährlich 461 Euro Ersparnis bringen. Gutverdiener kommen sogar auf rund 847 Euro im Jahr. Wichtig: Eine Ersparnis wird je nach Verdienst durch ein höheres zu versteuerndes Einkommen um rund 25 bis 35 Prozent geschmälert.
Extra-Leistungen sind viel Geld wert
Arztbesuch, Medikamente, Krankenhaus und Früherkennungsuntersuchungen – für die meisten Leistungen ist es egal, bei welcher Krankenkasse man versichert ist, denn die medizinische Versorgung ist gesetzlich geregelt. 95 Prozent der medizinischen Leistungen sind bei allen Kassen gleich.
Versicherte können dennoch ihren Schutz optimieren – denn die Kassen bieten zusätzlich zum gesetzlich festgelegten Umfang zahlreiche Extraleistungen an. Das sind etwa Zuschüsse zu einer professionellen Zahnreinigung oder Osteopathie, Übernahme der Kosten für Reiseimpfungen oder Bonusprogramme für gesundheitsbewusstes Verhalten. Viele Kassen zahlen im Falle einer schweren Erkrankung auch mehr als gesetzlich festgelegt für Haushaltshilfen oder häusliche Krankenpflege.
Tipps zur Kassenwahl: Was eine gute Krankenkasse bieten sollte
Die optimale Krankenkasse für alle gibt es nicht. Im Gegensatz zu anderen Portalen geben wir keine Bewertungen ab und ermitteln auch keine Testsieger. Denn je nach Alter, Bedarf oder Lebenssituation können unterschiedliche Leistungen wichtig sein.
Bei Unzufriedenheit wechseln. Allgemein gilt: Eine gute Krankenversicherung sollte sich um Ihre Anliegen zeitnah kümmern, ansprechbar sein und im Fall einer ernsten Erkrankung die medizinische Versorgung optimal unterstützen und beraten – und auch Zahlungen wie Krankengeld oder Kinderkrankengeld nicht lange aufschieben. Bietet Ihre Kasse das nicht und sind Sie unzufrieden, können Sie zu einer anderen Kasse wechseln. Dabei sollten Sie aber auch die Extraleistungen im Blick haben, die zusätzlich zur festgeschriebenen Gesundheitsversorgung angeboten werden. Ein Wechsel nur wegen ein paar Euro Beitragsersparnis lohnt nicht – wenn die neue Kasse kostspielige und für Sie wichtige Extras nicht bezahlt. Sie müssen zwölf Monate Mitglied bei Ihrer Krankenkasse sein, um wechseln zu können. Erhöht die Kasse den Zusatzbeitrag, haben Sie ein Sonderkündigungsrecht. Dann können Sie auch schon vor Ablauf der Sperrfrist wechseln.
Extraleistungen nutzen. Sie können nicht nur sparen, wenn Sie zu einer Kasse mit günstigerem Beitragssatz wechseln, sondern auch, indem Sie die Leistungen Ihrer Kasse besser nutzen. Mit manchen Angeboten kommen mehrere hundert Euro im Jahr zusammen. So bieten einige Kassen zum Beispiel finanzielle Vorteile, wenn Sie an bestimmten Programmen teilnehmen oder sich gesundheitsbewusst verhalten (Bonusprogramme). Oder sie zahlen Zuschüsse für Gesundheitskurse und finanzieren sportmedizinische Untersuchungen. Wer was bietet, erfahren Sie, wenn Sie den Krankenkassenvergleich freischalten.
Finanzlage checken. Es gibt Anhaltspunkte, anhand derer Sie grob beurteilen können, wie gut es einer Krankenkasse geht. Das können zum Beispiel hohe Rücklagen sein. Jede Kasse muss mindestens 20 Prozent der auf einen Monat entfallenden Ausgaben zurücklegen. Unsere Datenbank zeigt, wie gut die einzelnen Kassen finanziell aufgestellt sind.
Spezielle Versorgungsformen beachten. Hausarztmodelle, zusätzliche Versorgungs- und Behandlungsangebote für chronisch Kranke (Disease Management Programme) und besondere Versorgungsverträge der Kassen können Ihre Behandlung verbessern. Die wichtigsten Informationen dazu finden Sie in unserem Krankenkassenvergleich. Nicht alle Ärzte nehmen an diesen Programmen teil. Den Arzt wechseln sollten Sie aber nur, wenn Sie mit einer besseren medizinischen Behandlung rechnen können.
In fünf Schritten zur besten Krankenkasse – so gehen Sie vor
1. Bundesland auswählen. Wenn Sie unseren Krankenkassenvergleich nutzen, wählen Sie zunächst Ihr Bundesland aus. Sie sehen dann alle gesetzlichen Kassen, die dort verfügbar sind. Sie können nur eine Kasse wählen, die in Ihrem Bundesland zugänglich ist. Bundesweit geöffnete Kassen sind das überall. Es gibt auch viele regional eingeschränkte Kassen.
2. Extras auswählen. Verfeinern Sie Ihre Auswahl, indem Sie nach einem günstigeren Beitragssatz und Extraleistungen filtern. Das können zum Beispiel besondere Leistungen rund um die Themen Impfung, Schwangerschaft, besondere Heilmethoden oder Zahnvorsorge sein.
3. Eigene Kasse auswählen. Möchten Sie nur Infos zu Ihrer aktuellen Kasse einsehen, können Sie Ihre Kasse direkt nach Auswahl Ihres Bundeslands anklicken.
4. Infos als PDF speichern. Sie können alle Informationen zu den Krankenkassen oder Ihren individuellen Kassenvergleich als PDF-Datei auf Ihrem Rechner speichern.
5. Auf Änderungen achten. Wir fragen alle Extraleistungen regelmäßig ab und aktualisieren unsere Datenbank entsprechend. Trotzdem kann es im Einzelfall sein, dass eine Kasse kurzfristig Leistungen streicht. Fragen Sie im Zweifelsfall vor einem Wechsel nach, ob eine Leistung, derentwegen Sie wechseln, weiterhin angeboten wird.
Pressemitteilung der Stiftung Warentest test.de: Krankenkassenvergleich 2025 - Jetzt noch günstige Krankenkassen mit guten Extras finden
Online-Shopping: Verbraucher:innen erwarten sichere Produkte
12/2024 -vzbv veröffentlicht Befragung zu Produktsicherheit auf Online-Marktplätzen - Nicht nur am Black Friday: Rabatte und Angebote locken viele Verbraucher:innen auf Online-Marktplätze wie Temu, ebay oder Amazon. Dabei vertraut ein Großteil der Menschen darauf, dass Produkte wie das neue Ladekabel, die neue Puppe oder der neue Saugroboter sicher sind und den gesetzlichen Vorgaben entsprechen. Das zeigt eine repräsentative forsa-Befragung im Auftrag des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv). Doch mit den großen Online-Marktplätzen kommen auch immer wieder unsichere Produkte in die EU. Damit Verbraucher:innen besser geschützt werden, sind strengere Vorgaben für Plattformbetreiber notwendig.
„Online-Marktplätze genießen ein hohes Vertrauen bei vielen Verbraucher:innen. Dieses Vertrauen ist nicht immer gerechtfertigt. Bestellen Verbraucher:innen bei Händlern außerhalb der EU, gibt es immer wieder Probleme mit der Einhaltung von Produktsicherheitsstandards und Verbraucherrechten. Die Betreiber von Online-Marktplätzen haben eine Verantwortung. Dieser müssen sie sich stellen und Verbraucher:innen besser vor unsicheren Produkten schützen", sagt Jutta Gurkmann, Leiterin Geschäftsbereich Verbraucherpolitik beim vzbv.
Hohe Erwartungen an Online-Marktplätze
Verbraucher:innen haben hohe Erwartungen an Online-Marktplätze, die ihr Angebot an den deutschen oder europäischen Markt richten: Ein Großteil der Befragten erwartet, dass auf Online-Marktplätzen angebotene Produkte sicher sind und den gesetzlichen Anforderungen der EU entsprechen (93 Prozent stimmen voll und ganz bzw. eher zu). Ebenfalls 93 Prozent der befragten Verbraucher:innen erwarten, dass Betreiber von Online-Marktplätzen Verantwortung dafür übernehmen, dass auf dem Online-Marktplatz nur sichere und ungefährliche Produkte angeboten werden. Gut neun von zehn Befragten sehen die Betreiber von Online-Marktplätzen in der Pflicht zu haften, wenn ein Problem nicht durch den Händler gelöst wird (91 Prozent stimmen voll und ganz bzw. eher zu).
Ein Großteil der Befragten gibt zudem an, in den vergangenen zwölf Monaten auf einem Online-Marktplatz eingekauft zu haben (nur 18 Prozent haben dies nicht getan). Dabei ist knapp acht von zehn (79 Prozent) Menschen beim Einkauf auf Online-Marktplätzen sehr oder eher wichtig, dass auf den ersten Blick zu erkennen ist, wohin man die Ware bei einem Widerruf zurückschicken kann, aus welchem Land die Ware versendet wird und wer der Verkäufer ist.
Der vzbv setzt sich dafür ein, dass die Betreiber von Online-Marktplätzen mehr Verantwortung für das Geschehen auf ihrer Plattform tragen, denn schließlich verdienen sie daran. So sollten sie etwa genauer hinschauen, inwieweit Produktsicherheits- und Verbraucherrechte auf ihrer Plattform eingehalten werden. Außerdem sollten sie prüfen, ob gefährliche Produkte vertrieben werden, bevor diese Verbraucher:innen zugänglich gemacht werden. Tun sie das nicht, sollten sie für Schäden haften.
Pressemitteilung der vbz: Online-Shopping: Verbraucher:innen erwarten sichere Produkte
Produktsicherheit auf Online-Marktplätzen | Chartbericht | September 2024
Studie zeigt: Verbraucher:innen wünschen sich Warnhinweis auf Mogelpackungen
12/2024 -vzbv fordert mehr Transparenz im Supermarkt - Nur noch 500 Gramm statt 600 Gramm Müsli in der Packung oder ein Fruchtsaft wird zum Fruchtnektar mit Zuckerwasser – bei gleichbleibendem oder sogar steigendem Preis. Zu solchen Mogelpackungen gehen auf dem Portal Lebensmittelklarheit.de regelmäßig Beschwerden ein. Denn in Supermarktregalen finden sich immer mehr Mogelpackungen. Verbraucher:innen wünschen sich einen klaren Warnhinweis auf der Verpackung, wenn sich Inhalt oder Zutaten ändern. Das zeigt eine repräsentative Befragung im Auftrag des Projekts Lebensmittelklarheit. Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) fordert mehr Transparenz im Supermarkt.
„Die Befragung zeigt: Verbraucher:innen fühlen sich durch Mogelpackungen getäuscht. Lebensmittelhersteller müssen in die Pflicht genommen werden, transparent über Änderungen bei ihren Produkten zu informieren“, so Michaela Schröder, Geschäftsbereichsleiterin Verbraucherpolitik im vzbv.
Verbraucher:innen fühlen sich durch Mogelpackungen getäuscht
81 Prozent der Befragten als Täuschung wahr. Das gilt sowohl für „Shrinkflation“ (Veränderung des Inhalts bei gleichbleibendem oder steigendem Preis) als auch für „Skimpflation“ (Austausch von hochwertigen Zutaten durch kostengünstigere Inhaltsstoffe). Das Problem: Verbraucher:innen erkennen Mogelpackungen oftmals nicht.
Verbraucher:innen fühlen sich durch Mogelpackungen getäuscht
Ein Großteil der Befragten gibt zudem an, in den vergangenen zwölf Monaten auf einem Online-Marktplatz eingekauft zu haben (nur 18 Prozent haben dies nicht getan). Dabei ist knapp acht von zehn (79 Prozent) Menschen beim Einkauf auf Online-Marktplätzen sehr oder eher wichtig, dass auf den ersten Blick zu erkennen ist, wohin man die Ware bei einem Widerruf zurückschicken kann, aus welchem Land die Ware versendet wird und wer der Verkäufer ist.
Mogelpackungen mit Warnhinweis kennzeichnen
Mehr als acht von zehn Befragten (87 Prozent) sprachen sich dafür aus, dass Unternehmen gut sichtbar auf den Verpackungen darauf hinweisen sollten, wenn sich die Inhaltsmenge ändert. Bei einer Änderung der Zutaten war die Zustimmung ähnlich groß (86 Prozent). Wenn die Änderung durch einen Hinweis ersichtlich ist, empfindet die Mehrheit der Befragten diese als fair (68 Prozent bei Shrinkflation; 65 Prozent bei Skimkpflation). Der vzbv fordert, dass Mogelpackungen für mindestens sechs Monate mit einem Warnhinweis auf der Verpackung gekennzeichnet werden müssen.
„Verbraucher:innen müssen durch die gestiegenen Preise immer häufiger beim Lebensmitteleinkauf sparen. Mogelpackungen erschweren ihnen den Einkauf zusätzlich. Fairness sieht anders aus“, so Schröder. „Unfaire Praktiken der Hersteller beschädigen das Vertrauen der Verbraucher:innen in die Unternehmen der Lebensmittelindustrie und in die Wirtschaft. Es braucht mehr Transparenz und Fairness im Supermarkt.“
Geltende Regelungen in Europa
In Ungarn (seit 1. März 2024) und in Frankreich (seit 1. Juli 2024) müssen Lebensmitteleinzelhändler Mogelpackungen durch einen Hinweis am Regal kennzeichnen. Aus Sicht des vzbv sollte das BMUV die Lebensmittelhersteller als Verursacher der Mogelpackungen in die Pflicht nehmen.
Verbraucher:innen in Frankreich können Mogelpackungen bei einer staatlichen Stelle melden. Der vzbv fordert eine solche Meldestelle auch für Deutschland. Dafür kann das Portal Lebensmittelklarheit des vzbv dienen.
Pressemitteilung der vbz: Studie zeigt: Verbraucher:innen wünschen sich Warnhinweis auf Mogelpackungen
vzbv-Kurzpapier | Verbrauchertäuschung beenden - indirekte Preiserhöhungen unterbinden
Shrink- und Skimpflation bei Lebensmitteln: Indirekte Preiserhöhungen aus Verbraucherperspektive
Die Verbraucherstimmung in Deutschland setzt im Oktober ihre Erholung fort.
11/2024 -Die Verbraucherstimmung in Deutschland setzt im Oktober ihre Erholung fort. Da sich sowohl die Einkommenserwartung als auch die Anschaffungsneigung zum zweiten Mal nacheinander verbessern und die Sparneigung etwas zurück geht, steigt auch die Prognose des Konsumklimas zum zweiten Mal in Folge: Für November wird für das Konsumklima im Vergleich zum Vormonat (revidiert -21,0 Punkte) ein Anstieg von 2,7 Zähler auf -18,3 Punkte prognostiziert. Dies ist der höchste Wert seit April 2022 – wobei das Niveau des Konsumklimas nach wie vor niedrig ist. Zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung äußern sich die deutschen Verbraucher allerdings erneut etwas pessimistischer. Dies zeigen die aktuellen Ergebnisse des GfK Konsumklimas powered by NIM. Es wird seit Oktober 2023 gemeinsam von GfK und dem Nürnberg Institut für Marktentscheidungen (NIM), Gründer der GfK, herausgegeben.
Die gestiegene Anschaffungsneigung, aber vor allem die optimistischeren Einkommensaussichten führen dazu, dass das Konsumklima seine Erholung fortsetzen kann. Ein moderater Rückgang der Sparneigung um 4,8 Punkte unterstützt diese positive Entwicklung.
„Nach der leichten Verbesserung im Vormonat steigt das Konsumklima weiter an. Es klettert auf den höchsten Wert seit April 2022. Damals wurden, nach Beginn des Ukraine-Krieges, -15,7 Punkte gemessen“, erklärt Rolf Bürkl, Konsumexperte beim NIM. „Aber trotz des Anstiegs bleibt das Niveau des Konsumklimas nach wie vor überaus niedrig. Die Verunsicherung durch Krisen, Kriege und gestiegene Preise ist derzeit immer noch sehr ausgeprägt und verhindert, dass für den Konsum positive Faktoren, wie spürbare reale Einkommenszuwächse, nicht ihre volle Wirkung entfalten können. Meldungen über eine steigende Zahl an Unternehmensinsolvenzen und über Beschäftigungsabbaupläne bzw. Produktionsverlagerungen ins Ausland verhindern zudem eine deutlichere Erholung der Konsumstimmung“.
Negativtrend der Konjunkturerwartung setzt sich fort
Im Gegensatz zur Konsumstimmung sehen die deutschen Verbraucher die konjunkturelle Entwicklung für die kommenden 12 Monate erneut etwas pessimistischer. Die Konjunkturerwartungen sinken zum dritten Mal in Folge. Mit einem geringen Minus von 0,5 Zählern weist der Konjunkturindikator aktuell 0,2 Punkte auf. Ein geringerer Wert wurde zuletzt im März 2024 mit -3,1 Punkten gemessen.
So hat auch die Bundesregierung ihre ursprüngliche Prognose für das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr nach unten revidiert. Beim Bruttoinlandsprodukt wird jetzt ein Minus von 0,2 Prozent erwartet.
Einkommenserwartungen setzen Erholung fort
Die Erwartungen bezüglich der künftigen finanziellen Lage des eigenen Haushalts in den kommenden 12 Monaten wird von den Befragten zum zweiten Mal in Folge etwas optimistischer eingeschätzt. Der Indikator Einkommenserwartung legt gegenüber dem Vormonat um 3,6 Zähler zu und klettert damit auf 13,7 Punkte. Gegenüber dem entsprechenden Zeitraum des Vorjahres beträgt das Plus deutliche 29 Punkte.
Sinkende Inflationsraten in Verbindung mit deutlich steigenden Löhnen und Gehältern lassen derzeit die realen Einkommenszuwächse signifikant steigen. Auch die Rentner verfügen derzeit über reale Zuwächse bei ihren Einkünften. Dies nährt den Einkommensoptimismus.
Anschaffungsneigung klettert auf höchsten Stand seit März 2022
Der steigende Einkommensoptimismus sorgt bei der Anschaffungsneigung für Rückenwind. Der Indikator gewinnt 2,2 Zähler hinzu und weist nun -4,7 Punkte auf. Dies ist der höchste Stand seit mehr als zweieinhalb Jahren: Im März 2022 wurde zuletzt mit -2,1 Punkten ein besserer Wert gemessen. Die Anschaffungsneigung zeigt also momentan einen leicht steigenden Trend. Allerdings ist das Niveau nach wie vor sehr niedrig. Zudem können weitere belastende Umstände in den nächsten Monaten hinzukommen: Die Arbeitslosigkeit und die Zahl der Unternehmensinsolvenzen sind zuletzt leicht angestiegen. Dies wird die Sorgen um den Arbeitsplatz bei einer Reihe von Beschäftigten erhöhen. Und diese Sorge kann ein belastender Faktor für die Konsumneigung sein.
Pressemitteilung der NIQ: Konsumklima klettert auf den höchsten Stand seit April 2022
PDF-herunterladen: 202401029_PM_Konsumklima_Deutschland_dfin
Dynamische Stromtarife: 19 Millionen Haushalte im Dunkeln
11/2024 - Umfrage zeigt: Große Mehrheit der Haushalte in Deutschland ist schlecht informiert über dynamische Stromtarife – 19 Millionen Haushalte in Deutschland sind mit dynamischen Stromtarifen auch wenige Monate vor der flächendeckenden Einführung nicht vertraut. Das ergab eine forsa-Befragung im Auftrag des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv). 81 Prozent der Haushalte fühlen sich zu dynamischen Stromtarifen noch immer eher schlecht oder überhaupt nicht informiert. Mehr als die Hälfte kennt sie gar nicht. Ab dem Jahr 2025 müssen Stromanbieter dynamische Tarife verpflichtend anbieten. Ein Gutachten des vzbv zeigt: Für viele Haushalte kann sich ein dynamischer Stromtarif lohnen. Allerdings müssen Verbraucher:innen besser über die Tarife informiert werden.
„Mit dynamischen Stromtarifen können Verbraucher:innen an der Energiewende teilhaben und so direkt von günstigen Strompreisen an der Börse profitieren. Doch bei vielen Verbraucher:innen besteht noch immer ein großes Informationsdefizit“, sagt Jutta Gurkmann, Geschäftsbereichsleiterin beim vzbv. „Mit einer verbraucherfreundlichen Ausgestaltung dieser neuen Tarifangebote und klaren Informationen über deren Chancen und Risiken könnte man mehr Verbraucher:innen davon überzeugen.“
Absicherung gegen Preissteigerungen macht dynamische Stromtarife attraktiver
Wenn ab Januar 2025 alle Energieanbieter dynamische Stromtarife anbieten müssen, wird die Bedeutung dieser Tarife zunehmen. Beim Bekanntheitsgrad ist jedoch Luft nach oben: Etwas mehr als die Hälfte der Haushalte (53 Prozent) gibt an, dynamische Stromtarife nicht zu kennen. Zudem fühlen sich 81 Prozent der Haushalte schlecht oder überhaupt nicht über dynamische Stromtarife informiert.
Für Verbraucher:innnen spielt der Kostenaspekt bei der Wahl eines Stromtarifes eine große Rolle. Dynamische Stromtarife unterliegen den Preisschwankungen an den Spotmärkten. Dass diese Preisschwankungen an den Börsen auch vor Rekordhöhen nicht haltmachen, wurde während der Energiepreiskrise sichtbar. Für 72 Prozent der Befragten würde eine zusätzliche Absicherung gegen starke Preissteigerungen dynamische Stromtarife deutlich oder zumindest etwas attraktiver machen.
Dynamischer Stromtarif lohnt sich für viele Haushalte
Ein Gutachten des Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft im Auftrag des vzbv zeigt, dass sich der Abschluss dynamischer Stromtarife für viele Haushalte lohnen kann. Wenn Verbraucher:innen ihren Stromverbrauch an günstige Tageszeiten anpassen, können sie Geld sparen.
Ein großes Problem vieler dynamischer Tarife besteht jedoch in der mangelnden Transparenz der Preisbildung und der komplizierten Tarifstruktur. „Die jeweiligen Tarife kann jeder Anbieter unterschiedlich ausgestalten, was den Vergleich erschwert“, sagt Gurkmann. „Die wichtigsten Preisbestandteile und potenzielle Kostenrisiken sollten für Verbraucher:innen direkt ersichtlich und vergleichbar sein. Transparenz wird zum Erfolg beitragen.“
vzbv: Besser über dynamische Stromtarife informieren
Die Erkenntnisse des Gutachtens unterstreichen die Forderung des vzbv nach klaren Mindeststandards für Informationen über dynamische Stromtarife. Zudem sollten für Vergleichsportale klare Vorgaben gelten, sodass Verbraucher:innen Festpreisverträge und dynamische Verträge optimal vergleichen können. Der vzbv fordert zudem, dass Unternehmen Tarife anbieten, die eine Absicherung gegen exorbitante Preissteigerungen enthalten. „Das würde dynamische Tarife für weitere Verbrauchergruppen attraktiver machen“, sagt Gurkmann.
QUELLE
Pressemitteilung der vbzv: Dynamische Stromtarife: 19 Millionen Haushalte im Dunkeln
Downloads
Gutachten: Wie verbraucherfreundlich sind dynamische und variable Stromtarife?
Repräsentative Befragung zu dynamischen Stromtarifen
Digitaler Buzz und smarte Technologien beflügeln den Markt für technische Konsumgüter
10/2024 - Im ersten Halbjahr 2024 sanken die Umsätze von technischen Konsumgütern im Vergleich zum Vorjahr nur noch leicht, mit einem Umsatzrückgang von 0,5 Prozent. Experten von GfK/NIQ prognostizieren, dass sich der Markt 2024 insgesamt stabilisiert. Verbraucher beschränken sich nicht mehr nur auf das Nötigste, sondern kaufen sehr gezielt: Sie warten auf den idealen Zeitpunkt und suchen nach attraktiven Angeboten. Produkte, die durch innovative Features wie KI-Funktionen glänzen oder durch einen Hype in sozialen Medien Aufmerksamkeit erregen, können Interesse wecken und Kaufanreize setzen.
Die Konsumenten in Deutschland kaufen wieder: Das bringt positive Impulse in den gesamten Markt für technische Konsumgüter und führt zu einem Wachstum von 5 Prozent allein im Juni 2024. Gleichzeitig haben die Verbraucher gelernt, auf Rabatte zu warten: Mittlerweile wird jedes fünfte Produkt mit mindestens 10 Prozent Preisnachlass verkauft.
Social Media entfesselt Kaufkraft
Neukäufe werden entweder getätigt, um ein defektes Produkt zu ersetzen, sich das Leben einfacher zu machen oder um einen starken Wunsch zu befriedigen. Immer häufiger werden Nutzer durch Social Media auf neue Produkte aufmerksam. Besonders jüngere Generationen wie die Generation Z nutzen digitale Plattformen als Inspirationsquelle. Kreative und interaktive Inhalte lassen Kampagnen viral gehen und erzielen damit eine breite Aufmerksamkeit, was insbesondere bei Haushaltskleingeräten (4 Prozent Umsatzwachstum) und Telekommunikationsprodukten (2 Prozent Umsatzwachstum) im ersten Halbjahr zu einem verstärkten Wunsch der Konsumenten nach diesen Produkten und damit Umsatzwachstum führte. Beispielsweise stieg der Umsatz elektrischer Hairstyling-Produkte im ersten Halbjahr um knapp 14 Prozent, während elektrische Zahnpflegeprodukte um 11 Prozent zulegten. Auch Heißluftfritteusen, die eine gesunde Ernährung ermöglichen, boomen weiter mit einem Umsatzwachstum von 51 Prozent.
In diesen beiden Sektoren finden sich viele Produktinnovationen und eine starke Tendenz zu Premiumisierung, da Konsumenten zunehmend bereit sind, mehr Geld für Produkte aus diesen Bereichen auszugeben. Der durchschnittliche Kaufpreis für ein neues Smartphone stieg im ersten Halbjahr auf mittlerweile 677 Euro.
“Haushaltskleingeräte und Telekommunikationsprodukte sind derzeit lukrative Marktsegmente, in denen Marken durch gezielte Social-Media-Kampagnen Marktanteile gewinnen können. Die verstärkte Ausgabenbereitschaft für Smartphones und kleine Haushaltsgeräte führt jedoch zu einer Kannibalisierung anderer Kategorien, da Konsumenten ihr Budget nur einmal ausgeben können”, erklärt Alexander Dehmel, Experte für technische Konsumgüter bei GfK/NielsenIQ. Dazu kommt, dass einige Sektoren sich noch nicht von der Kaufzurückhaltung der Konsumenten während der Hochzeit der Inflation erholt haben. Dies hat im ersten Halbjahr noch zu Umsatzverlusten in Bereichen wie IT (4 Prozent Rückgang), Foto (3 Prozent Rückgang), Haushaltsgroßgeräten (2 Prozent Rückgang) und Unterhaltungselektronik (2 Prozent Rückgang) geführt. Im zweiten Quartal verzeichneten aber viele Sektoren einen verbesserten Marktumsatz.
Der nächste Schritt für smarte Produkte
Vernetzte Produkte haben einen immer größeren Anteil an den Produktportfolios. Bereits 23 Prozent aller Umsätze im Haushaltsgerätesektor entfallen auf smarte Geräte. Besonders im Bereich Sicherheit und Hausausstattung erzielten vernetzte Sicherheitskameras, Thermostate und Lampen 33 Prozent des Umsatzes.
„Angetrieben von neuen Chip-Generationen, ermöglichen erste KI-Computer bereits die Nutzung generativer KI auf dem eigenen Rechner. Um von den Konsumenten akzeptiert zu werden, müssen die KI-gesteuerten Produkte aber einen erkennbaren Mehrwert bieten. Hier sind Hersteller und Händler gefragt, um die Innovationen mit passenden Anwendungen und passender Zielgruppenkommunikation zum Erfolg zu führen“, stellt Alexander Dehmel fest.
Multifunktionale und energieeffiziente Produkte zeigen kräftiges Wachstum
Auch in Bereichen, die insgesamt leicht rückläufig sind, gab es im ersten Halbjahr 2024 ein klares Wachstum bei Produkten, die mehrere Funktionen kombinieren, Energie sparen oder das Leben der Konsumenten verbessern. Beispielsweise verzeichneten Laptops mit stromsparenden OLED-Displays ein Umsatzwachstum von 23 Prozent, während der Notebook-Markt insgesamt einen Rückgang von 12 Prozent hinnehmen musste. Waschmaschinen mit Dampffunktion zeigten einen Zuwachs von 16 Prozent, im Vergleich zu stagnierenden Verkaufszahlen im Gesamtmarkt. Ähnlich verhielt es sich bei Geschirrspülern: Modelle mit EU-Energielabel A wuchsen um 28 Prozent, während der Rest des Marktes stagnierte. Bei Kühlschränken war der Unterschied noch deutlicher, mit einem Wachstum von 54 Prozent für energieeffiziente Modelle gegenüber einem Rückgang von 5 Prozent bei herkömmlichen Geräten.
Ausblick und positive Entwicklungen
Die Fußballeuropameisterschaft hat zu einem merklichen Anstieg der Verkaufszahlen im Bereich Unterhaltungselektronik geführt. Viele Hersteller nutzten das Event für gezielte Promotions. Im zweiten Quartal 2024 wuchs der Markt für Fernseher daher um 21 Prozent. Damit zeigt sich erneut: Die Wirkung eines sportlichen Großereignis auf das Konsumverhalten und den Markt ist nicht zu unterschätzen. Für den Rest des Jahres ist es aber entscheidend, wie sich das Vertrauen der Konsumenten in die wirtschaftliche und politische Lage entwickelt. Denn nur mit Vertrauen in die Zukunft sind Verbraucher auch bereit zu konsumieren.
QUELLE
Pressemitteilung der GfK: Digitaler Buzz und smarte Technologien beflügeln den Markt für technische Konsumgüter
Die News als PDF-herunterladen
Mit einer Datenmaut hätten Verbraucher:innen das Nachsehen
09/2024 -Statement Lina Ehrig, Leitung Team Digitales und Medien des vzbv zum Netzgebührenstreit zwischen Meta und Telekom - Meta hat verkündet, seine Peering-Partnerschaft mit der Deutschen Telekom beenden zu wollen. Anlass war ein Gerichtsentscheid und gescheiterte Verhandlungen, die Datenübertragung via Telekom unentgeltlich zu ermöglichen. Dazu Lina Ehrig, Leiterin Team Digitales und Medien beim vzbv.
„Verbraucher:innen müssen sich darauf verlassen können, dass sie auf alle Inhalte im Internet gleichermaßen zugreifen können. Bisher müssen Internetanbieter in Europa im Sinne der Netzneutralität alle Daten bei der Übertragung gleich behandeln. Sie dürfen Inhalte nicht verlangsamen, blockieren oder bevorzugen. Der Fall Telekom gegen Meta zeigt, wie fragil das Prinzip der Netzneutralität ist. Denn seit Jahren setzen sich die Telekom und andere Netzbetreiber dafür ein, dass sie von Inhalteanbietern wie ARD, Netflix oder Meta eine Netzgebühr als Datenmaut verlangen können. Der Verbraucherzentrale Bundesverband lehnt eine Datenmaut entschieden ab.
Eine Datenmaut würde die Netzneutralität schwächen. Sie gefährdet das offene und freie Internet. Denn im schlimmsten Fall könnten Telekommunikationsanbieter über eine Datenmaut entscheiden, welche Inhalte wie zu Verbraucher:innen durchgeleitet werden: Wer nicht ausreichend zahlt, wird nicht oder nur langsam gesendet. Dann könnten Kund:innen trotz ihrer monatlichen Zahlungen an Netzbetreiber, Streaming- und Clouddienste nicht auf alle Inhalte im Netz gleichermaßen zugreifen.
Dabei wird für die Bereitstellung der Infrastruktur bereits bezahlt: über die Internettarife der Verbraucher:innen. Mit der Datenmaut wollen sich die Netzbetreiber also doppelt für ihre Netze bezahlen lassen. Die Leidtragenden wären am Ende auch hier die Verbraucher:innen: Wenn Inhalteanbieter die Datenmaut auf ihre Kund:innen abwälzen, sind es die Verbraucher:innen, die doppelt zur Kasse gebeten werden.“
QUELLE
Pressemitteilung der vbz: Mit einer Datenmaut hätten Verbraucher:innen das Nachsehen
Mit der Fünf-Punkte-Strategie den Markt schlagen
10/2024 -Mit der eigenen Geldanlage den Markt schlagen – diesen Traum haben viele Anlegerinnen und Anleger. Wer risikofreudig ist und sich aktiv um seine Geldanlage kümmern möchte, dem helfen die Finanzexperten der Stiftung Warentest nun bei der Renditejagd.
Marktbreite ETF sind mit ihrer Einfachheit, Transparenz und den günstigen Kosten für viele Anleger erste Wahl. Nur wenige aktiv gemanagte Fonds schaffen es in ihrer Vergleichsgruppe, den Markt zu schlagen – gelegentlich jedoch gelingt es. Mit der Fünf-Punkte-Strategie gibt Finanztest aktiven Anlegerinnen und Anlegern jetzt eine Möglichkeit an die Hand, die Rendite ihres Depots systematisch mit solchen Top-Fonds zu optimieren.
Der Ratgeber „Mit Top-Fonds auf Renditejagd“ zeigt, wie und nach welchen Kriterien die Finanztest-Expertinnen und Experten Fonds bewerten und erklärt im Detail, wie die Fünf-Punkte-Strategie auf Basis dieser Fondsbewertung funktioniert. Das Buch erläutert Chancen und Risiken der Fünf-Punkte-Strategie und zeigt mit Hilfe umfangreicher Backtests, wie gut die Strategie in verschiedenen Fondsgruppen wie Aktienfonds Europa oder Aktienfonds USA funktioniert hat.
„Diese Strategie erfordert deutlich mehr Einsatz und Interesse als eine einfache Buy-and-hold-Strategie. Deshalb ist sie eher für aktive Anlegerinnen und Anleger geeignet, die ihre Geldanlage regelmäßig kontrollieren und bei Bedarf umschichten können“, so Thomas Krüger, Finanzanalyst bei der Stiftung Warentest. „Wir konnten jedoch zeigen, dass sich der Aufwand für zusätzliche Rendite in manchen Fondsgruppen gelohnt hat.“
Der Ratgeber „Mit Top-Fonds auf Renditejagd“ listet auf seinen 160 Seiten auch für wichtige Fondsgruppen die aktuellen und vergangenen Tops-Fonds der vergangenen drei Jahre. Das Buch gibt es ab dem 27. September 2024 für 22,90 Euro im Handel oder online unter www.test.de/renditejagd zu bestellen.
Pressemitteilung der Stiftung Warentest: Mit der Fünf-Punkte-Strategie den Markt schlagen
Deutlicher Rückschlag für das Konsumklima
09/2024 -Nach der deutlichen Erholung im Vormonat erleidet die Verbraucherstimmung in Deutschland im August einen herben Rückschlag. Die Einkommens- und Konjunkturerwartungen müssen spürbare Einbußen hinnehmen. Auch die Anschaffungsneigung geht etwas zurück. Da zudem die Sparneigung in diesem Monat ansteigt, trübt sich das Konsumklima ein: Es sinkt in der Prognose für September im Vergleich zum Vormonat (revidiert -18,6 Punkte) um 3,4 Zähler auf -22,0 Punkte. Dies zeigen die aktuellen Ergebnisse des GfK Konsumklimas powered by NIM. Es wird seit Oktober 2023 gemeinsam von GfK und dem Nürnberg Institut für Marktentscheidungen (NIM), Gründer der GfK, herausgegeben.
Das Konsumklima leidet derzeit vor allem unter dem Einbruch der Einkommensaussichten. Der leichte Anstieg der Sparneigung um 2,7 Punkte belastet zusätzlich die Konsumstimmung.
„Offenbar war die Euphorie, die die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland ausgelöst hat, nur ein kurzes Aufflackern und ist nach Ende des Turniers verflogen. Hinzu kommen negative Meldungen rund um die Arbeitsplatzsicherheit, die die Verbraucher wieder pessimistischer stimmen und eine schnelle Erholung der Konsumstimmung unwahrscheinlich erscheinen lassen“, erklärt Rolf Bürkl, Konsumexperte beim NIM. „Leicht steigende Arbeitslosenzahlen, eine Zunahme der Unternehmensinsolvenzen sowie Personalabbaupläne diverser Unternehmen in Deutschland lassen bei einer Reihe von Beschäftigten die Sorgen um ihren Arbeitsplatz zunehmen. Die Hoffnungen auf eine stabile und nachhaltige Erholung der Konjunktur müssen damit weiter verschoben werden.“
Die Einkommenserwartungen gehen spürbar zurück
Die privaten Haushalte in Deutschland sehen derzeit ihre finanzielle Lage in den nächsten 12 Monaten deutlich weniger rosig als noch vor einem Monat: Der Indikator Einkommenserwartung verliert 16,2 Punkte und rutscht auf 3,5 Punkte. Ein größerer Rückgang der Einkommensstimmung innerhalb eines Monats wurde zuletzt vor knapp zwei Jahren, im September 2022 gemessen. Damals mussten die privaten Haushalte durch Inflationsraten von knapp acht Prozent erhebliche Kaufkrafteinbußen hinnehmen.
Trotz der Kaufkraftzuwächse, die viele Haushalte derzeit real verzeichnen, greift offenbar wieder mehr Verunsicherung um sich. Die Sorgen um die Sicherheit des Arbeitsplatzes ist bei einer Reihe von Beschäftigten angestiegen. So meldete die Bundesagentur für Arbeit zuletzt wieder leicht steigende Arbeitslosenzahlen. Demnach liegt momentan die Zahl der arbeitslos gemeldeten Personen um etwa 200.000 höher als vor einem Jahr.
Die Anschaffungsneigung im Sog sinkender Einkommensaussichten
Von den deutlich gesunkenen Einkommenserwartungen bleibt auch die Anschaffungsneigung der deutschen Verbraucher nicht unbeeindruckt. Allerdings fallen die Verluste mit 2,5 Zählern vergleichsweise moderat aus. Der Indikator weist damit im August -10,9 Punkte auf. Im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum des Vorjahres steht immer noch ein Plus von gut 6 Punkten zu Buche.
Konjunkturerwartungen im Auf und Ab
Das Auf und Ab der Konjunkturaussichten, das seit Mai 2024 zu beobachten ist, setzt sich auch im August fort. Nach dem deutlichen Zuwachs von 7,3 Zählern im Vormonat verliert der Indikator aktuell 7,8 Punkte. Er weist derzeit 2,0 Punkte auf.
Eine schwächelnde Konjunktur, Stellenabbaupläne in der deutschen Industrie, ein Anstieg der Insolvenzzahlen sowie ein zunehmendes Rezessionsrisiko verunsichern die Konsumenten und lassen den Konjunkturpessimismus für die kommenden 12 Monate steigen.
Pressemitteilung der GfK: Deutlicher Rückschlag für das Konsumklima
Die News als PDF-herunterladen
Hohe Lebensmittelpreise: Politik muss für Transparenz sorgen
09/2024 -Ob Zucker, Butter oder Gemüse: Die hohen Lebensmittelpreise machen Verbraucher:innen zu schaffen. Nach wie vor weiß in Deutschland niemand, wie diese Preise entstehen. In anderen europäischen Ländern gibt es Preisbeobachtungsstellen, die Preise und Kosten vom Acker bis ins Supermarktregal erfassen. Ein Gutachten im Auftrag des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) zeigt: Eine solche Stelle ist auch in Deutschland umsetzbar. Der vzbv fordert die Einrichtung einer Preisbeobachtungsstelle – für mehr Transparenz und fairere Preise.
„Die Bundesregierung muss endlich Licht ins Dunkel der Preisgestaltung bei Lebensmitteln bringen. Eine Preisbeobachtungsstelle kann unfaire Praktiken aufdecken und so Verbraucher:innen vor zu hohen Preisen an der Ladentheke schützen. Länder wie Spanien und Frankreich machen es vor. Deutschland muss nachziehen“, so Ramona Pop, Vorständin des vzbv.
Lebensmittelpreise als Black Box
Seit dem Jahr 2021 sind die Lebensmittelpreise in Deutschland insgesamt um fast 33 Prozent gestiegen, während die Gesamtinflationsrate bei 20 Prozent liegt. Die hohen Preise bei Lebensmitteln lassen sich nicht allein durch höhere Produktionskosten erklären. Wie sich die Preise zusammensetzen und wer am Ende wie viel Gewinn einstreicht, ist unklar. Mit einer Preisbeobachtungsstelle lassen sich Rückschlüsse auf Inflationstreiber ziehen.
„Die Lebensmittelpreise gleichen einer Blackbox. Die hohen Umsätze der Lebensmittelindustrie geben Anlass zur Vermutung, dass hier auf Kosten von Verbraucher:innen Kasse gemacht wird. Eine gesunde, ausgewogene Ernährung wird immer mehr zu einer Frage des Geldbeutels. Das darf nicht sein“, so Pop.
Preisbeobachtungsstelle auch in Deutschland möglich
Der vzbv hat bei der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI) eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Das Gutachten zeigt: Eine Preisbeobachtungsstelle entlang der Lebensmittelwertschöpfungskette – also von der Erzeugung bis zum Verkauf – lässt sich in Deutschland umsetzen. Viele notwendige Daten sind bereits vorhanden.
Um die gesamte Wertschöpfungskette abzudecken, sollte die Bundesregierung bestehende Datenlücken identifizieren und schließen. Meldeverordnungen müssen angepasst oder neu eingeführt werden.
„Die Fakten liegen auf dem Tisch. Jetzt ist die Bundesregierung am Zug. Faire Lebensmittelpreise für Verbraucher:innen sollten eine Selbstverständlichkeit sein“, so Pop.
Vorhandene Strukturen nutzen: Einrichtung beim BLE
Aus Sicht des vzbv sollte die Preisbeobachtungsstelle bei der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) angesiedelt werden. So können die dort bereits bestehenden Strukturen und Ressourcen genutzt und darauf aufgebaut werden.
Der Fokus der Preisbeobachtungsstelle sollte zunächst auf frischen, wenig verarbeiteten Grundnahrungsmitteln liegen und im Anschluss auf weitere Produkte ausgeweitet werden.
Die Ergebnisse der Preisbeobachtung sollten dem Bundestag in Form eines jährlichen Berichts vorgelegt werden. Auf dieser Basis könnte der Gesetzgeber die Wettbewerbssituation im Agrar- und Lebensmittelmarkt diskutieren und politische Maßnahmen ableiten.
Preisbeobachtung auf EU-Ebene
Die Europäische Kommission widmet sich ebenfalls der Preisbeobachtung. Sie hat im April 2024 die Agriculture and Food Chain Observatory (AFCO) eingerichtet. Aus Sicht des vzbv sollte sich die Bundesregierung auf europäischer Ebene für einheitliche Berichtspflichten sowie einheitliche Auswertungs- und Erhebungsmethoden einsetzen. So wird eine Preisbeobachtung im gesamten europäischen Binnenmarkt möglich.
Downloads
vzbv-Kurzpapier: Mehr Transparenz bei Lebensmittelpreisen | August 2024
Machbarkeitsstudie zur Einrichtung einer Preisbeobachtungsstelle | Juli 2024
Quelle „vzbv“
Das können die 0-Euro-Konten
08/2024 - Fürs Konto nichts zahlen? Das geht, zeigt der neue Girokonten-Test der Stiftung Warentest. Zehn Konten im Test sind für jeden kostenlos. Wer Bedingungen erfüllen kann, hat sogar noch mehr Gratis-Auswahl.
Schlappe 300 Euro im Jahr kostet das teuerste, 0 Euro das günstigste. Der neue Girokonten-Test der Stiftung Warentest zeigt: Bei zehn Banken bekommen Verbraucherinnen und Verbraucher aktuell bedingungslos ein Konto für umme.
„Für diese Konten muss nur regelmäßig Geld oder Gehalt eingehen, egal wie hoch. Sonst müssen keine weiteren Bedingungen erfüllt werden. Außerdem sind alle grundlegenden Bankleistungen inklusive, wie Überweisungen, eine Karte und Kartenzahlungen. Bei fünf Konten können Verbraucherinnen und Verbraucher sogar eine Filiale aufsuchen“, sagt Heike Nicodemus, Finanz-Expertin der Stiftung Warentest.
Bei 17 weiteren Banken und Sparkassen ist ein kostenloses Girokonto an Bedingungen geknüpft, erläutert die Expertin: „Wer monatlich Gehalt oder Rente in einer bestimmten Höhe auf sein Konto erhält, der bekommt auch bei großen Filialbanken ein kostenloses Konto. Bei einigen reichen hier schon 700,- Euro monatlich, die Frankfurter Sparkasse fordert stolze 5.000 Euro Geldeingang für ein Gratis-Konto. Einige Anbieter setzen auch eine bestimmte Anzahl an Transaktionen oder eine Newsletter-Anmeldung voraus.“
Viel mehr Gratis-Auswahl gibt es für junge Erwachsene, bei einigen sogar bis 30 Jahren: Für sie sind 146 der geprüften Konten kostenlos, oft allerdings für junge Leute im Studium oder in der Ausbildung.
Insgesamt bewerten die Testerinnen und Tester der Stiftung Warentest einen Kontoführungspreis von bis zu 60 Euro im Jahr als akzeptabel. Die gute Nachricht: Trotz allgemeiner Preissteigerungen ist die Zahl der Girokonten in diesem Preissegment im vergangenen Jahr gleichgeblieben. Die Modellperson im Test hat die Auswahl aus 73 fairen Angeboten.
Der gesamte Girokonten-Test mit allen Ergebnissen erscheint in der September-Ausgabe der Zeitschrift Finanztest und unter www.test.de/girokonten.
gibt es eine ständig aktualisierte Preisübersicht über alle Kontomodelle, egal ob gratis, günstig oder teuer.Quelle „Stiftung Warentest“